
Das Beste für deine Ziele – leckere Rezepte, Tipps für deine Gesundheit & Wissenswertes zu Wirkstoffen

Hilfe – mein Körper befindet sich in den Wechseljahren
Früher oder später wird jede Frau damit konfrontiert werden: den Wechseljahren. Welche Veränderungen im weiblichen Körper während der Wechseljahre stattfinden und wie du deinen Körper in dieser Phase unterstützen kannst,...
Alle Beiträge

Wasserhaushalt im Körper – warum Trinken allein nicht ausreicht
Jeder spricht davon, ausreichend Flüssigkeit aufzunehmen. Doch was viele dabei vergessen: Es ist nicht nur entscheidend, wie viel du trinkst, sondern vor allem, was du trinkst. Wenn es um den Wasserhaushalt geht, dann ist eines besonders entscheidend: Wie gut dein Körper mit Elektrolyten versorgt ist. Was Elektrolyte sind und warum sie eine so große Rolle hinsichtlich des Wasserhaushaltes einnehmen, erfährst du im Folgenden. Was sind Elektrolyte Elektrolyte sind elektrisch geladene Teilchen, die sich in Körperflüssigkeiten befinden. Hierzu zählen unter anderem Natrium, Chlorid, Kalium, Magnesium, Calcium und Hydrogencarbonat. Deshalb sind Elektrolyte entscheidend Ohne ein Gleichgewicht der Elektrolyte kann der Körper Wasser nicht richtig in den Zellen speichern, oder zwischen den Kompartimenten (z.B. Blutbahn und Gewebe) verschieben. Ein Elektrolytgleichgewicht ist darüber hinaus entscheidend für den Blutdruck, die Funktion von Nerven und Muskeln, die Zellkommunikation sowie den pH-Wert im Blut. Ohne Elektrolyte kann der Körper Wasser weder effizient speichern noch nutzen. Beim Schwitzen verlierst du nicht nur Flüssigkeit Viele Menschen - besonders Sporttreibende, Menschen, die häufig in die Sauna gehen, oder solche, die bei Hitze stark schwitzen – trinken zwar (hoffentlich) ausreichend Wasser, vergessen jedoch häufig den Ausgleich der verlorenen Elektrolyte. Beim Schwitzen verliert der Körper nicht nur Wasser, sondern auch Elektrolyte wie Natrium, Calcium und Magnesium. Wird dieser Verlust nun ausschließlich durch reines Wasser ersetzt, kann sich das Verhältnis zwischen Wasser und Elektrolyten verschieben. Das Ergebnis: Muskelkrämpfe Schwächegefühl, Schwindel Kopfschmerzen Hyponatriämie (ein zu niedriger Natriumspiegel im Blut), was lebensbedrohlich werden kann Wodurch können Elektrolyte aufgenommen werden? Elektrolyte werden im Optimalfall über die Ernährung und Mineralwasser aufgenommen. Natrium ist beispielsweise in Salz vorzufinden, Magnesium in Nüssen, Vollkorn und Hülsenfrüchten, Calcium in Milchprodukten und grünem Gemüse und Kalium in Bananen, Aprikosen oder Kartoffeln Mit Hilfe eines calcium- und magnesiumreichen Mineralwassers, einer Prise Salz und dem Saft einer Zitrone kann darüber hinaus ein selbstgemachtes Elektrolytgetränk hergestellt werden. Auch der Einsatz von Elektrolyt-Pulvern kann schnelle Abhilfe schaffen. Fazit Die Gleichung „viel trinken = gesund“ ist nur die halbe Wahrheit. Entscheidend ist, dass dein Körper auch die nötigen Elektrolyte erhält, um mit dem aufgenommenen Wasser richtig umgehen zu können. Elektrolyte helfen, Flüssigkeit dort zu halten, wo sie gebraucht wird, und unterstützen wichtige Körperfunktionen. Merke: Trinke klug, nicht nur viel. Quellen: Biesalski HK, Bischoff SC, Pirlich M, Weimann A (2018): Ernährungsmedizin. Nach dem Curriculum Ernährungsmedizin der Bundesärztekammer. 5., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Georg Thieme Verlag KG Spasovski G, Vanholder R, Allolio B, Annane D, Ball S, Bichet D, Decaux G, Fenske W, Hoorn EJ, Ichai C, Joannidis M, Soupart A, Zietse R, Haller M, van der Veer S, Van Biesen W, Nagler E; Hyponatraemia Guideline Development Group (2014): Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia. Eur J Endocrinol; 170(3):G1-47
Wasserhaushalt im Körper – warum Trinken allein nicht ausreicht
Jeder spricht davon, ausreichend Flüssigkeit aufzunehmen. Doch was viele dabei vergessen: Es ist nicht nur entscheidend, wie viel du trinkst, sondern vor allem, was du trinkst. Wenn es um den Wasserhaushalt geht, dann ist eines besonders entscheidend: Wie gut dein Körper mit Elektrolyten versorgt ist. Was Elektrolyte sind und warum sie eine so große Rolle hinsichtlich des Wasserhaushaltes einnehmen, erfährst du im Folgenden. Was sind Elektrolyte Elektrolyte sind elektrisch geladene Teilchen, die sich in Körperflüssigkeiten befinden. Hierzu zählen unter anderem Natrium, Chlorid, Kalium, Magnesium, Calcium und Hydrogencarbonat. Deshalb sind Elektrolyte entscheidend Ohne ein Gleichgewicht der Elektrolyte kann der Körper Wasser nicht richtig in den Zellen speichern, oder zwischen den Kompartimenten (z.B. Blutbahn und Gewebe) verschieben. Ein Elektrolytgleichgewicht ist darüber hinaus entscheidend für den Blutdruck, die Funktion von Nerven und Muskeln, die Zellkommunikation sowie den pH-Wert im Blut. Ohne Elektrolyte kann der Körper Wasser weder effizient speichern noch nutzen. Beim Schwitzen verlierst du nicht nur Flüssigkeit Viele Menschen - besonders Sporttreibende, Menschen, die häufig in die Sauna gehen, oder solche, die bei Hitze stark schwitzen – trinken zwar (hoffentlich) ausreichend Wasser, vergessen jedoch häufig den Ausgleich der verlorenen Elektrolyte. Beim Schwitzen verliert der Körper nicht nur Wasser, sondern auch Elektrolyte wie Natrium, Calcium und Magnesium. Wird dieser Verlust nun ausschließlich durch reines Wasser ersetzt, kann sich das Verhältnis zwischen Wasser und Elektrolyten verschieben. Das Ergebnis: Muskelkrämpfe Schwächegefühl, Schwindel Kopfschmerzen Hyponatriämie (ein zu niedriger Natriumspiegel im Blut), was lebensbedrohlich werden kann Wodurch können Elektrolyte aufgenommen werden? Elektrolyte werden im Optimalfall über die Ernährung und Mineralwasser aufgenommen. Natrium ist beispielsweise in Salz vorzufinden, Magnesium in Nüssen, Vollkorn und Hülsenfrüchten, Calcium in Milchprodukten und grünem Gemüse und Kalium in Bananen, Aprikosen oder Kartoffeln Mit Hilfe eines calcium- und magnesiumreichen Mineralwassers, einer Prise Salz und dem Saft einer Zitrone kann darüber hinaus ein selbstgemachtes Elektrolytgetränk hergestellt werden. Auch der Einsatz von Elektrolyt-Pulvern kann schnelle Abhilfe schaffen. Fazit Die Gleichung „viel trinken = gesund“ ist nur die halbe Wahrheit. Entscheidend ist, dass dein Körper auch die nötigen Elektrolyte erhält, um mit dem aufgenommenen Wasser richtig umgehen zu können. Elektrolyte helfen, Flüssigkeit dort zu halten, wo sie gebraucht wird, und unterstützen wichtige Körperfunktionen. Merke: Trinke klug, nicht nur viel. Quellen: Biesalski HK, Bischoff SC, Pirlich M, Weimann A (2018): Ernährungsmedizin. Nach dem Curriculum Ernährungsmedizin der Bundesärztekammer. 5., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Georg Thieme Verlag KG Spasovski G, Vanholder R, Allolio B, Annane D, Ball S, Bichet D, Decaux G, Fenske W, Hoorn EJ, Ichai C, Joannidis M, Soupart A, Zietse R, Haller M, van der Veer S, Van Biesen W, Nagler E; Hyponatraemia Guideline Development Group (2014): Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia. Eur J Endocrinol; 170(3):G1-47

Bitterstoffe sind deine Freunde
Wie Bitterstoffe zum Überleben beitragen Bittere Substanzen sind häufig in giftigen Pflanzen oder verdorbenen Lebensmitteln vorzufinden. Die Fähigkeit, einen bitteren Geschmack zu erkennen, half im Laufe der Evolution somit, das Vorhandensein möglicher Toxine (Giftstoffe) zu bemerken und dadurch deren Verzehr zu meiden. Sind alle Bitterstoffe giftig? Viele Bitterstoffe sind im Allgemeinen gut verträglich, ohne toxisch zu wirken. Pflanzliche Bitterstoffe werden zu den sogenannten sekundären Pflanzenstoffen gezählt, die gesundheitsfördernd wirken können. Bitterstoffe triggern nicht nur Rezeptoren in der Mundhöhle Bitterrezeptoren sind nicht nur in der Mundhöhle, sondern im gesamten Magen-Darm-Trakt aufzufinden. Einige Studien deuten darauf hin, dass Bitterstoffe nicht nur vor Toxinen in der Nahrung schützen, sondern darüber hinaus unter anderem Einfluss auf die Nahrungsaufnahme und die Darmbewegung nehmen können. Der Einsatz von Bitterstoffen hat Tradition In der westlichen und östlichen Kräutermedizin sind bittere Heilkräuter ein fester Bestandteil und dafür bekannt, die Verdauung zu unterstützen, indem sie unter anderem die Freisetzung von Verdauungssäften stimulieren und die Darmbewegung anregen sollen. Bitterstoffe in präklinischen Studien Präklinische Studien sind Studien, die mit Zellkulturen oder Versuchstieren durchgeführt werden. Somit handelt es sich hierbei nicht um Humanstudien (Studien, die an Menschen durchgeführt werden). Dies ist wichtig zu betonen, denn präklinische Studien dienen dazu, die Sicherheit und mögliche Wirksamkeit gewisser Substanzen zu untersuchen, bevor sie am Menschen getestet werden. Die Ergebnisse können aus diesem Grund nicht 1:1 auf den Menschen übertragen werden. Präklinische Studien deuten darauf hin, dass bittere Substanzen die Ausschüttung von Hormonen im Magen-Darm-Trakt stimulieren und die Darmbewegung beeinflussen können. Zudem könnte die Nahrungsaufnahme reduziert und (aufgrund einer langsameren Magenentleerung) der Blutzuckeranstieg nach Mahlzeiten gesenkt werden. Diese Erkenntnisse haben das Interesse an der möglichen Verwendung von Bitterstoffen bei der Behandlung und Vorbeugung von Adipositas und deren Begleiterkrankungen, insbesondere Diabetes mellitus Typ 2, geweckt. Um abschließende Aussagen über eine verbesserte langfristige Blutzuckerkontrolle, einschließlich Gewichtsverlust treffen zu können, müssten jedoch gut durchgeführte Studien am Menschen durchgeführt werden. Bisher wurden nur wenige Studien diesbezüglich am Menschen durchgeführt. Die beobachteten positiven Effekte waren eher moderat und die Ergebnisse uneinheitlich. In welchen Lebensmitteln sind Bitterstoffe enthalten? Bitterstoffe sind in Lebensmitteln wie Artischocken, Chicorée, Rucola, Brokkoli, Rosenkohl und Pflanzen wie Löwenzahn, Mariendistel, Brennnessel, Gerstengras und der Moringa-Pflanze enthalten. Auch in Kaffee und Kakao sind Bitterstoffe zu finden. Neben Bitterstoffen enthalten diese Lebensmittel bzw. Pflanzen eine Vielzahl von Mikronährstoffen – das bedeutet: Vitamine und Mineralstoffe - weshalb sie im Optimalfall regelmäßig in das Ernährungsmuster integriert werden sollten. Fazit Bitterstoffe können Hinweise auf Toxizität und verdorbene Lebensmittel geben. Viele Bitterstoffe, die beispielsweise in Kräutern oder Gemüsesorten wie Kohlgemüse vorkommen, sind jedoch gut verträglich und nehmen seit Jahrhunderten einen festen Platz in der traditionellen Medizin ein. Die Studienlage zu Bitterstoffen ist begrenzt. Einige Daten deuten jedoch darauf hin, dass sie sich unter anderem positiv auf die Verdauung und Nahrungsaufnahme auswirken können. Quellen: Rezaie P, Bitarafan V, Horowitz M, Feinle-Bisset C (2021): Effects of Bitter Substances on GI Function, Energy Intake and Glycaemia-Do Preclinical Findings Translate to Outcomes in Humans? Nutrients; 13(4):1317 Chou WL (2021): Therapeutic potential of targeting intestinal bitter taste receptors in diabetes associated with dyslipidemia. Pharmacol Res; 170:105693
Bitterstoffe sind deine Freunde
Wie Bitterstoffe zum Überleben beitragen Bittere Substanzen sind häufig in giftigen Pflanzen oder verdorbenen Lebensmitteln vorzufinden. Die Fähigkeit, einen bitteren Geschmack zu erkennen, half im Laufe der Evolution somit, das Vorhandensein möglicher Toxine (Giftstoffe) zu bemerken und dadurch deren Verzehr zu meiden. Sind alle Bitterstoffe giftig? Viele Bitterstoffe sind im Allgemeinen gut verträglich, ohne toxisch zu wirken. Pflanzliche Bitterstoffe werden zu den sogenannten sekundären Pflanzenstoffen gezählt, die gesundheitsfördernd wirken können. Bitterstoffe triggern nicht nur Rezeptoren in der Mundhöhle Bitterrezeptoren sind nicht nur in der Mundhöhle, sondern im gesamten Magen-Darm-Trakt aufzufinden. Einige Studien deuten darauf hin, dass Bitterstoffe nicht nur vor Toxinen in der Nahrung schützen, sondern darüber hinaus unter anderem Einfluss auf die Nahrungsaufnahme und die Darmbewegung nehmen können. Der Einsatz von Bitterstoffen hat Tradition In der westlichen und östlichen Kräutermedizin sind bittere Heilkräuter ein fester Bestandteil und dafür bekannt, die Verdauung zu unterstützen, indem sie unter anderem die Freisetzung von Verdauungssäften stimulieren und die Darmbewegung anregen sollen. Bitterstoffe in präklinischen Studien Präklinische Studien sind Studien, die mit Zellkulturen oder Versuchstieren durchgeführt werden. Somit handelt es sich hierbei nicht um Humanstudien (Studien, die an Menschen durchgeführt werden). Dies ist wichtig zu betonen, denn präklinische Studien dienen dazu, die Sicherheit und mögliche Wirksamkeit gewisser Substanzen zu untersuchen, bevor sie am Menschen getestet werden. Die Ergebnisse können aus diesem Grund nicht 1:1 auf den Menschen übertragen werden. Präklinische Studien deuten darauf hin, dass bittere Substanzen die Ausschüttung von Hormonen im Magen-Darm-Trakt stimulieren und die Darmbewegung beeinflussen können. Zudem könnte die Nahrungsaufnahme reduziert und (aufgrund einer langsameren Magenentleerung) der Blutzuckeranstieg nach Mahlzeiten gesenkt werden. Diese Erkenntnisse haben das Interesse an der möglichen Verwendung von Bitterstoffen bei der Behandlung und Vorbeugung von Adipositas und deren Begleiterkrankungen, insbesondere Diabetes mellitus Typ 2, geweckt. Um abschließende Aussagen über eine verbesserte langfristige Blutzuckerkontrolle, einschließlich Gewichtsverlust treffen zu können, müssten jedoch gut durchgeführte Studien am Menschen durchgeführt werden. Bisher wurden nur wenige Studien diesbezüglich am Menschen durchgeführt. Die beobachteten positiven Effekte waren eher moderat und die Ergebnisse uneinheitlich. In welchen Lebensmitteln sind Bitterstoffe enthalten? Bitterstoffe sind in Lebensmitteln wie Artischocken, Chicorée, Rucola, Brokkoli, Rosenkohl und Pflanzen wie Löwenzahn, Mariendistel, Brennnessel, Gerstengras und der Moringa-Pflanze enthalten. Auch in Kaffee und Kakao sind Bitterstoffe zu finden. Neben Bitterstoffen enthalten diese Lebensmittel bzw. Pflanzen eine Vielzahl von Mikronährstoffen – das bedeutet: Vitamine und Mineralstoffe - weshalb sie im Optimalfall regelmäßig in das Ernährungsmuster integriert werden sollten. Fazit Bitterstoffe können Hinweise auf Toxizität und verdorbene Lebensmittel geben. Viele Bitterstoffe, die beispielsweise in Kräutern oder Gemüsesorten wie Kohlgemüse vorkommen, sind jedoch gut verträglich und nehmen seit Jahrhunderten einen festen Platz in der traditionellen Medizin ein. Die Studienlage zu Bitterstoffen ist begrenzt. Einige Daten deuten jedoch darauf hin, dass sie sich unter anderem positiv auf die Verdauung und Nahrungsaufnahme auswirken können. Quellen: Rezaie P, Bitarafan V, Horowitz M, Feinle-Bisset C (2021): Effects of Bitter Substances on GI Function, Energy Intake and Glycaemia-Do Preclinical Findings Translate to Outcomes in Humans? Nutrients; 13(4):1317 Chou WL (2021): Therapeutic potential of targeting intestinal bitter taste receptors in diabetes associated with dyslipidemia. Pharmacol Res; 170:105693

Diesen Mineralstoff solltest du dir genauer ansehen: Magnesium
Magnesium zählt zu den sogenannten Mineralstoffen und muss (da der menschliche Körper es nicht selbständig bilden kann) zwingend über die Ernährung aufgenommen werden. In etwa 99 % des gesamten Körpermagnesiums befinden sich in Knochen, Muskeln und dem umgebenden Weichgewebe. Ein Drittel des im Knochengewebe enthaltenen Magnesiums dient als Reservoir und sorgt für einen normalen Magnesiumspiegel im Blut. Mit zunehmendem Alter nimmt der Magnesiumgehalt der Knochen ab, was zu einer Verschlechterung ihrer Speicherfunktion führt. Magnesium ist an einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen - einschließlich der Energieproduktion - beteiligt, weshalb eine ausreichende Versorgung für die allgemeine Gesundheit unerlässlich ist. Diese Lebensmittel sind reich an Magnesium Insbesondere Lebensmittel wie Vollkornprodukte, grünes Blattgemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, Fisch und Meeresfrüchte sind reich an Magnesium. Trotz geringer Magnesiumgehalte tragen laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung e.V. (auf Grund der Verzehrmenge und -häufigkeit) auch Lebensmittel wie Bananen, Kartoffeln, Fleisch sowie Milch- und Milchprodukte zur Magnesiumversorgung bei. Mögliche Symptome einer unzureichenden Magnesiumversorgung Eine unzureichende Magnesiumversorgung kann nicht nur durch eine magnesiumarme Ernährung, sondern auch durch chronischen Alkoholkonsum, lange Krankenhausaufenthalte, oder chronische Erkrankungen wie Diabetes mellitus Typ 2, Adipositas oder dem metabolischen Syndrom entstehen. Magnesium ist unter anderem entscheidend für die Muskelkontraktion, die Regulation des Herzrhythmus, des Blutdrucks und für den Knochenstoffwechsel, wodurch eine unzureichende Magnesiumversorgung unter anderem zu Muskelkrämpfen und Herzrhythmusstörungen beitragen kann. Zudem wird vermutet, dass ein Magnesiummangel sowohl mit Angstzuständen als auch mit depressiven Störungen in Zusammenhang steht. Health Claims, die für Magnesium bisher formuliert wurden Health Claims sind gesundheitsbezogene Angaben, die nur dann formuliert werden, wenn genügend Daten zu diesen Angaben zur Verfügung stehen. Für Magnesium wurden unter anderem folgende Health Claims formuliert: Magnesium trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei Magnesium trägt zum Elektrolytgleichgewicht bei Magnesium trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems und einer normalen Muskelfunktion bei Magnesium trägt zur normalen psychischen Funktion bei Magnesium trägt zur Erhaltung normaler Knochen und Zähne bei Magnesium ist in verschiedenen Formen erhältlich Eventuell ist dir bereits aufgefallen, dass es verschiedene Magnesiumformen gibt. Magnesiumformen, die in der Praxis in der Regel gut vertragen und zugleich gut vom Körper aufgenommen werden können, sind beispielsweise Magnesium-Bisglycinat, Magnesium-Citrat, Magnesium-Acetyltaurat sowie Magnesium-Malat. Tierstudien zeigen, dass Magnesium-Acetyltaurat schnell aufgenommen wird und leicht ins Gehirn gelangt. Diese Magnesiumverbindung wird in Studien unter anderem zur Behandlung von Migräne empfohlen. Während Magnesium-Acetyltaurat die Magnesiumkonzentration im Gehirn von Mäusen auch bei geringer Dosis erhöhte, erhöhten Magnesium-Bisglycinat und -citrat den Magnesiumspiegel im Gehirn nur bei hohen Dosen. Der Magnesiumspiegel in der Muskulatur stieg (dosisabhängig) nur in der Gruppe mit hochdosiertem Magnesiumcitrat an. Bezüglich der Bioverfügbarkeit verschiedener Magnesium-Formen sollten zwingend gut durchgeführte Studien am Menschen durchgeführt werden, die entsprechende Magnesiumspiegel im Blut und Gewebe untersuchen und vergleichen. Fazit Achte auf eine magnesiumreiche Ernährung vollgepackt mit Lebensmitteln wie Vollkornprodukten, grünem Blattgemüse, Hülsenfrüchten, Nüssen, Samen, Fisch und Meeresfrüchten. Auch ein magnesiumreiches Mineralwasser kann dir helfen, deinen Magnesiumbedarf zu decken. Individuell kann Magnesium in Form eines Nahrungsergänzungsmittels supplementiert werden. Achte hierbei auf eine individuell gute Verträglichkeit. Quellen: Uysal N, Kizildag S, Yuce Z, Guvendi G, Kandis S, Koc B, Karakilic A, Camsari UM, Ates M (2019): Timeline (Bioavailability) of Magnesium Compounds in Hours: Which Magnesium Compound Works Best? Biol Trace Elem Res; 187(1):128-136 Ates M, Kizildag S, Yuksel O, Hosgorler F, Yuce Z, Guvendi G, Kandis S, Karakilic A, Koc B, Uysal N (2019): Dose-Dependent Absorption Profile of Different Magnesium Compounds. Biol Trace Elem Res; 192(2):244-251 Verordnung (EU) Nr. 432/2012 der Kommission vom 16. Mai 2012
Diesen Mineralstoff solltest du dir genauer ansehen: Magnesium
Magnesium zählt zu den sogenannten Mineralstoffen und muss (da der menschliche Körper es nicht selbständig bilden kann) zwingend über die Ernährung aufgenommen werden. In etwa 99 % des gesamten Körpermagnesiums befinden sich in Knochen, Muskeln und dem umgebenden Weichgewebe. Ein Drittel des im Knochengewebe enthaltenen Magnesiums dient als Reservoir und sorgt für einen normalen Magnesiumspiegel im Blut. Mit zunehmendem Alter nimmt der Magnesiumgehalt der Knochen ab, was zu einer Verschlechterung ihrer Speicherfunktion führt. Magnesium ist an einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen - einschließlich der Energieproduktion - beteiligt, weshalb eine ausreichende Versorgung für die allgemeine Gesundheit unerlässlich ist. Diese Lebensmittel sind reich an Magnesium Insbesondere Lebensmittel wie Vollkornprodukte, grünes Blattgemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, Fisch und Meeresfrüchte sind reich an Magnesium. Trotz geringer Magnesiumgehalte tragen laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung e.V. (auf Grund der Verzehrmenge und -häufigkeit) auch Lebensmittel wie Bananen, Kartoffeln, Fleisch sowie Milch- und Milchprodukte zur Magnesiumversorgung bei. Mögliche Symptome einer unzureichenden Magnesiumversorgung Eine unzureichende Magnesiumversorgung kann nicht nur durch eine magnesiumarme Ernährung, sondern auch durch chronischen Alkoholkonsum, lange Krankenhausaufenthalte, oder chronische Erkrankungen wie Diabetes mellitus Typ 2, Adipositas oder dem metabolischen Syndrom entstehen. Magnesium ist unter anderem entscheidend für die Muskelkontraktion, die Regulation des Herzrhythmus, des Blutdrucks und für den Knochenstoffwechsel, wodurch eine unzureichende Magnesiumversorgung unter anderem zu Muskelkrämpfen und Herzrhythmusstörungen beitragen kann. Zudem wird vermutet, dass ein Magnesiummangel sowohl mit Angstzuständen als auch mit depressiven Störungen in Zusammenhang steht. Health Claims, die für Magnesium bisher formuliert wurden Health Claims sind gesundheitsbezogene Angaben, die nur dann formuliert werden, wenn genügend Daten zu diesen Angaben zur Verfügung stehen. Für Magnesium wurden unter anderem folgende Health Claims formuliert: Magnesium trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei Magnesium trägt zum Elektrolytgleichgewicht bei Magnesium trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems und einer normalen Muskelfunktion bei Magnesium trägt zur normalen psychischen Funktion bei Magnesium trägt zur Erhaltung normaler Knochen und Zähne bei Magnesium ist in verschiedenen Formen erhältlich Eventuell ist dir bereits aufgefallen, dass es verschiedene Magnesiumformen gibt. Magnesiumformen, die in der Praxis in der Regel gut vertragen und zugleich gut vom Körper aufgenommen werden können, sind beispielsweise Magnesium-Bisglycinat, Magnesium-Citrat, Magnesium-Acetyltaurat sowie Magnesium-Malat. Tierstudien zeigen, dass Magnesium-Acetyltaurat schnell aufgenommen wird und leicht ins Gehirn gelangt. Diese Magnesiumverbindung wird in Studien unter anderem zur Behandlung von Migräne empfohlen. Während Magnesium-Acetyltaurat die Magnesiumkonzentration im Gehirn von Mäusen auch bei geringer Dosis erhöhte, erhöhten Magnesium-Bisglycinat und -citrat den Magnesiumspiegel im Gehirn nur bei hohen Dosen. Der Magnesiumspiegel in der Muskulatur stieg (dosisabhängig) nur in der Gruppe mit hochdosiertem Magnesiumcitrat an. Bezüglich der Bioverfügbarkeit verschiedener Magnesium-Formen sollten zwingend gut durchgeführte Studien am Menschen durchgeführt werden, die entsprechende Magnesiumspiegel im Blut und Gewebe untersuchen und vergleichen. Fazit Achte auf eine magnesiumreiche Ernährung vollgepackt mit Lebensmitteln wie Vollkornprodukten, grünem Blattgemüse, Hülsenfrüchten, Nüssen, Samen, Fisch und Meeresfrüchten. Auch ein magnesiumreiches Mineralwasser kann dir helfen, deinen Magnesiumbedarf zu decken. Individuell kann Magnesium in Form eines Nahrungsergänzungsmittels supplementiert werden. Achte hierbei auf eine individuell gute Verträglichkeit. Quellen: Uysal N, Kizildag S, Yuce Z, Guvendi G, Kandis S, Koc B, Karakilic A, Camsari UM, Ates M (2019): Timeline (Bioavailability) of Magnesium Compounds in Hours: Which Magnesium Compound Works Best? Biol Trace Elem Res; 187(1):128-136 Ates M, Kizildag S, Yuksel O, Hosgorler F, Yuce Z, Guvendi G, Kandis S, Karakilic A, Koc B, Uysal N (2019): Dose-Dependent Absorption Profile of Different Magnesium Compounds. Biol Trace Elem Res; 192(2):244-251 Verordnung (EU) Nr. 432/2012 der Kommission vom 16. Mai 2012

Gesunde Zähne durch die richtige Ernährung
Die Zahngesundheit beginnt nicht erst beim Zahnarzt, sondern bereits auf deinem Teller. Die Lebensmittel, die gegessen werden, beeinflussen nicht nur die Verdauung, die Nährstoffversorgung des Körpers und das Gewicht, sondern auch die Zahngesundheit und das empfindliche Gleichgewicht des Mikrobioms im Mund. Du hörst richtig! Auch im Mund befindet sich eine Ansammlung von Mikroben, die (wie beispielsweise im Darm oder auf der Haut) ein Mikrobiom bilden. Dieses Mikrobiom kann durch verschiedene Einflussfaktoren beeinflusst werden. Dessen Zusammensetzung kann sich nicht nur positiv oder negativ auf die Zahngesundheit, sondern auf die gesamte Allgemeingesundheit auswirken. Im Folgenden wird dargestellt, wie Ernährung, Mundgesundheit und Allgemeingesundheit miteinander verknüpft sind und worauf du achten solltest, um langfristig gesund zu bleiben. Zucker – der Feind deiner Zähne Zucker ist ein bekannter Risikofaktor für Karies, das wissen wir alle. Doch warum ist das so? Essen wir Zucker, füttern wir damit bestimmte Bakterien im Mund – insbesondere Streptococcus mutans. Die Höhe der Konzentration dieses Bakteriums im Speichel korreliert eng mit dem Kariesrisiko, da diese Mikroorganismen bei der Verstoffwechselung von Zucker Säuren produzieren, die den Zahnschmelz angreifen. Dies führt zur Entmineralisierung der Zähne – was das Risiko für Karies erhöht. Je häufiger Zucker konsumiert wird, desto öfter kommt es zu diesen „Säureattacken“. Besonders problematisch ist hierbei „versteckter Zucker“ in Fertigprodukten, Softdrinks, Fruchtjoghurt oder Müsliriegeln. Diese Produkte enthalten oftmals große Mengen an Zucker, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen. Säurehaltige Getränke – ein unterschätztes Risiko Nicht nur Zucker, sondern auch Säuren in Lebensmitteln und Getränken können den Zähnen schaden. Getränke wie Fruchtsäfte, Softdrinks, Energy-Drinks oder gar „gesunde“ Smoothies können den pH-Wert im Mund senken und zum direkten Abtrag von Zahnhartsubstanz führen (ganz ohne Beteiligung von Bakterien). Trinkst du regelmäßig säurehaltige Getränke, vielleicht sogar in kleinen Schlucken über den ganzen Tag verteilt, sind deine Zähne quasi einem Dauerangriff ausgesetzt. Tipp: Nach dem Konsum solcher Getränke solltest du mit Wasser nachspülen und nicht sofort die Zähne putzen, da dies den Zahnschmelz zusätzlich schädigen kann. Zahnfleischentzündungen Zahnfleischentzündungen entstehen meist, wenn sich bakterielle Beläge (Plaque) auf den Zähnen bilden und das Zahnfleisch reizen. Wird die Entzündung chronisch, kann daraus eine Parodontitis resultieren. Die Parodontitis ist eine Erkrankung, bei der sich Zahnfleisch und Kieferknochen zurückbilden. Studien zeigen, dass Parodontitis nicht nur ein zahnmedizinisches Problem ist, sondern auch im Zusammenhang mit chronischen Erkrankungen wie beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus Typ 2 und Atemwegserkrankungen steht. Mikrobiom im Mund In unserem Mund leben eine Vielzahl verschiedener Bakterienarten, die gemeinsam das Mikrobiom bilden. Überwiegen die „guten“ Bakterien, bleibt unser Mund gesund. Gerät das Gleichgewicht, durch beispielsweise einem hohen Konsum von Zucker, schlechter Mundhygiene, Stress oder Medikamenteneinnahme aus der Bahn, kann nicht nur das Risiko für Karies, oder Parodontitis steigern, sondern auch die Allgemeingesundheit darunter leiden. Der Mund ist der Beginn des Verdauungstraktes. Studien zeigen, dass die Bakterien im Mund in direkter Verbindung mit dem Darmmikrobiom stehen. Entzündungen im Mund können beispielsweise das Risiko einer Dysbalance im Darmmikrobiom nach sich ziehen. 5 Tipps, wie du deine Zähne und dein Mund Mikrobiom stärkst Reduziere Zucker Trinke Wasser statt Softdrinks Achte auf eine ballaststoffreiche Ernährung Achte darauf, dein Essen ausreichend zu kauen (dies erhöht den Speichelfluss, der remineralisierend wirkt) Achte auf eine ausreichende Mundhygiene Fazit Unsere Ernährung beeinflusst nicht nur unser Körpergewicht und unsere Verdauung, sondern ganz unmittelbar unsere Zahngesundheit. Wer sich ausgewogen ernährt, Zucker und Zucker gesüßte Getränke meidet, kann nicht nur Karies und Zahnfleischentzündungen vorbeugen, sondern seine allgemeine Gesundheit fördern. Der Weg zu einem gesunden Körper beginnt im Mund. Quellen: Isola G (2020): The Impact of Diet, Nutrition and Nutraceuticals on Oral and Periodontal Health. Nutrients; 12(9):2724 Valenzuela MJ, Waterhouse B, Aggarwal VR, Bloor K, Doran T (2021): Effect of sugar-sweetened beverages on oral health: a systematic review and meta-analysis. Eur J Public Health; 31(1):122-129 Kitamoto S, Nagao-Kitamoto H, Hein R, Schmidt TM, Kamada N (2020): The Bacterial Connection between the Oral Cavity and the Gut Diseases. J Dent Res; 99(9):1021-1029. Xi M, Ruan Q, Zhong S, Li J, Qi W, Xie C, Wang X, Abuduxiku N, Ni J (2024): Periodontal bacteria influence systemic diseases through the gut microbiota. Front Cell Infect Microbiol; 14:1478362
Gesunde Zähne durch die richtige Ernährung
Die Zahngesundheit beginnt nicht erst beim Zahnarzt, sondern bereits auf deinem Teller. Die Lebensmittel, die gegessen werden, beeinflussen nicht nur die Verdauung, die Nährstoffversorgung des Körpers und das Gewicht, sondern auch die Zahngesundheit und das empfindliche Gleichgewicht des Mikrobioms im Mund. Du hörst richtig! Auch im Mund befindet sich eine Ansammlung von Mikroben, die (wie beispielsweise im Darm oder auf der Haut) ein Mikrobiom bilden. Dieses Mikrobiom kann durch verschiedene Einflussfaktoren beeinflusst werden. Dessen Zusammensetzung kann sich nicht nur positiv oder negativ auf die Zahngesundheit, sondern auf die gesamte Allgemeingesundheit auswirken. Im Folgenden wird dargestellt, wie Ernährung, Mundgesundheit und Allgemeingesundheit miteinander verknüpft sind und worauf du achten solltest, um langfristig gesund zu bleiben. Zucker – der Feind deiner Zähne Zucker ist ein bekannter Risikofaktor für Karies, das wissen wir alle. Doch warum ist das so? Essen wir Zucker, füttern wir damit bestimmte Bakterien im Mund – insbesondere Streptococcus mutans. Die Höhe der Konzentration dieses Bakteriums im Speichel korreliert eng mit dem Kariesrisiko, da diese Mikroorganismen bei der Verstoffwechselung von Zucker Säuren produzieren, die den Zahnschmelz angreifen. Dies führt zur Entmineralisierung der Zähne – was das Risiko für Karies erhöht. Je häufiger Zucker konsumiert wird, desto öfter kommt es zu diesen „Säureattacken“. Besonders problematisch ist hierbei „versteckter Zucker“ in Fertigprodukten, Softdrinks, Fruchtjoghurt oder Müsliriegeln. Diese Produkte enthalten oftmals große Mengen an Zucker, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen. Säurehaltige Getränke – ein unterschätztes Risiko Nicht nur Zucker, sondern auch Säuren in Lebensmitteln und Getränken können den Zähnen schaden. Getränke wie Fruchtsäfte, Softdrinks, Energy-Drinks oder gar „gesunde“ Smoothies können den pH-Wert im Mund senken und zum direkten Abtrag von Zahnhartsubstanz führen (ganz ohne Beteiligung von Bakterien). Trinkst du regelmäßig säurehaltige Getränke, vielleicht sogar in kleinen Schlucken über den ganzen Tag verteilt, sind deine Zähne quasi einem Dauerangriff ausgesetzt. Tipp: Nach dem Konsum solcher Getränke solltest du mit Wasser nachspülen und nicht sofort die Zähne putzen, da dies den Zahnschmelz zusätzlich schädigen kann. Zahnfleischentzündungen Zahnfleischentzündungen entstehen meist, wenn sich bakterielle Beläge (Plaque) auf den Zähnen bilden und das Zahnfleisch reizen. Wird die Entzündung chronisch, kann daraus eine Parodontitis resultieren. Die Parodontitis ist eine Erkrankung, bei der sich Zahnfleisch und Kieferknochen zurückbilden. Studien zeigen, dass Parodontitis nicht nur ein zahnmedizinisches Problem ist, sondern auch im Zusammenhang mit chronischen Erkrankungen wie beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus Typ 2 und Atemwegserkrankungen steht. Mikrobiom im Mund In unserem Mund leben eine Vielzahl verschiedener Bakterienarten, die gemeinsam das Mikrobiom bilden. Überwiegen die „guten“ Bakterien, bleibt unser Mund gesund. Gerät das Gleichgewicht, durch beispielsweise einem hohen Konsum von Zucker, schlechter Mundhygiene, Stress oder Medikamenteneinnahme aus der Bahn, kann nicht nur das Risiko für Karies, oder Parodontitis steigern, sondern auch die Allgemeingesundheit darunter leiden. Der Mund ist der Beginn des Verdauungstraktes. Studien zeigen, dass die Bakterien im Mund in direkter Verbindung mit dem Darmmikrobiom stehen. Entzündungen im Mund können beispielsweise das Risiko einer Dysbalance im Darmmikrobiom nach sich ziehen. 5 Tipps, wie du deine Zähne und dein Mund Mikrobiom stärkst Reduziere Zucker Trinke Wasser statt Softdrinks Achte auf eine ballaststoffreiche Ernährung Achte darauf, dein Essen ausreichend zu kauen (dies erhöht den Speichelfluss, der remineralisierend wirkt) Achte auf eine ausreichende Mundhygiene Fazit Unsere Ernährung beeinflusst nicht nur unser Körpergewicht und unsere Verdauung, sondern ganz unmittelbar unsere Zahngesundheit. Wer sich ausgewogen ernährt, Zucker und Zucker gesüßte Getränke meidet, kann nicht nur Karies und Zahnfleischentzündungen vorbeugen, sondern seine allgemeine Gesundheit fördern. Der Weg zu einem gesunden Körper beginnt im Mund. Quellen: Isola G (2020): The Impact of Diet, Nutrition and Nutraceuticals on Oral and Periodontal Health. Nutrients; 12(9):2724 Valenzuela MJ, Waterhouse B, Aggarwal VR, Bloor K, Doran T (2021): Effect of sugar-sweetened beverages on oral health: a systematic review and meta-analysis. Eur J Public Health; 31(1):122-129 Kitamoto S, Nagao-Kitamoto H, Hein R, Schmidt TM, Kamada N (2020): The Bacterial Connection between the Oral Cavity and the Gut Diseases. J Dent Res; 99(9):1021-1029. Xi M, Ruan Q, Zhong S, Li J, Qi W, Xie C, Wang X, Abuduxiku N, Ni J (2024): Periodontal bacteria influence systemic diseases through the gut microbiota. Front Cell Infect Microbiol; 14:1478362

Funktionelle Lebensmittel – Mehr als nur Nahrung?!
Sie lassen sich in Supermärkten und in den sozialen Medien finden: Joghurt mit lebenden Bakterienkulturen, Proteinriegel, ACE-Getränke oder Getränke mit Adaptogenen wie z.B. Vitalpilzen. Willkommen in der Welt der „funktionellen Lebensmitteln“ auch „Designer-Lebensmittel“ oder „Nutraceuticals“ genannt. Was sind funktionelle Lebensmittel? Der Begriff beschreibt Lebensmittel, die über ihren reinen Nährwert hinaus gesundheitsfördernde Effekte erzielen sollen. Funktionelle Lebensmittel sind keine Nährstoffkonzentrate wie Nahrungsergänzungsmittel, sondern gelangen in typischen Lebensmittel Formaten z.B. in Form eines Getränks oder Joghurts in den Handel. Lebensmittel / Getränke werden oftmals mit Vitaminen, sekundären Pflanzenstoffen oder speziellen Bakterienkulturen angereichert. Der Begriff „Funktionelle Lebensmittel“ ist rechtlich nicht definiert. Lebensmittelhersteller, die mit gewissen Vorzügen der Produkte werben möchten, müssen sich jedoch an die sogenannte Health-Claims-Verordnung richten. In dieser Verordnung wird geregelt, mit welchen gesundheitsbezogenen Aussagen geworben werden darf. Funktionelle Lebensmittel, die (wahrscheinlich) jeder kennt Die größte Marktbedeutung (hinsichtlich der funktionellen Lebensmitteln) haben derzeit probiotische Milcherzeugnisse. Auch Wellness-Getränke (die beispielsweise mit Aloe Vera, Acerola oder Ginkgo versetzt werden) oder ACE-Getränke haben einen festen Platz im Produktsortiment vieler Lebensmittel- bzw. Getränkehändler. ACE-Getränke sind Getränke, die mit den Vitaminen A, C und E angereichert werden. Neben klassischen Durstlöschern werden oftmals auch Pflanzendrinks wie Haferdrinks oder Sojadrinks mit Calcium, Vitamin B12 und Vitamin D angereichert. Diese Produkte können (nach Anreicherung) ebenfalls zu den funktionellen Lebensmitteln gezählt werden. Für wen können funktionelle Lebensmittel sinnvoll sein? Für Menschen mit besonderen Bedürfnissen (z.B. Sportler) oder Menschen, die gezielt Lebensmittelgruppen aus dem Ernährungsmuster ausklammern (z.B. vegan lebende Menschen) können sich funktionelle Lebensmittel eignen. Funktionelle Lebensmittel können helfen, die Nährstoffaufnahme zu verbessern, indem sie in ein ausgewogenes Ernährungsmuster integriert werden. Ein ausgewogenes Ernährungsmuster können sie jedoch nicht ersetzen. Ein Proteinriegel beispielsweise stellt keinen adäquaten Ersatz einer ausgewogenen Mahlzeit dar.
Funktionelle Lebensmittel – Mehr als nur Nahrung?!
Sie lassen sich in Supermärkten und in den sozialen Medien finden: Joghurt mit lebenden Bakterienkulturen, Proteinriegel, ACE-Getränke oder Getränke mit Adaptogenen wie z.B. Vitalpilzen. Willkommen in der Welt der „funktionellen Lebensmitteln“ auch „Designer-Lebensmittel“ oder „Nutraceuticals“ genannt. Was sind funktionelle Lebensmittel? Der Begriff beschreibt Lebensmittel, die über ihren reinen Nährwert hinaus gesundheitsfördernde Effekte erzielen sollen. Funktionelle Lebensmittel sind keine Nährstoffkonzentrate wie Nahrungsergänzungsmittel, sondern gelangen in typischen Lebensmittel Formaten z.B. in Form eines Getränks oder Joghurts in den Handel. Lebensmittel / Getränke werden oftmals mit Vitaminen, sekundären Pflanzenstoffen oder speziellen Bakterienkulturen angereichert. Der Begriff „Funktionelle Lebensmittel“ ist rechtlich nicht definiert. Lebensmittelhersteller, die mit gewissen Vorzügen der Produkte werben möchten, müssen sich jedoch an die sogenannte Health-Claims-Verordnung richten. In dieser Verordnung wird geregelt, mit welchen gesundheitsbezogenen Aussagen geworben werden darf. Funktionelle Lebensmittel, die (wahrscheinlich) jeder kennt Die größte Marktbedeutung (hinsichtlich der funktionellen Lebensmitteln) haben derzeit probiotische Milcherzeugnisse. Auch Wellness-Getränke (die beispielsweise mit Aloe Vera, Acerola oder Ginkgo versetzt werden) oder ACE-Getränke haben einen festen Platz im Produktsortiment vieler Lebensmittel- bzw. Getränkehändler. ACE-Getränke sind Getränke, die mit den Vitaminen A, C und E angereichert werden. Neben klassischen Durstlöschern werden oftmals auch Pflanzendrinks wie Haferdrinks oder Sojadrinks mit Calcium, Vitamin B12 und Vitamin D angereichert. Diese Produkte können (nach Anreicherung) ebenfalls zu den funktionellen Lebensmitteln gezählt werden. Für wen können funktionelle Lebensmittel sinnvoll sein? Für Menschen mit besonderen Bedürfnissen (z.B. Sportler) oder Menschen, die gezielt Lebensmittelgruppen aus dem Ernährungsmuster ausklammern (z.B. vegan lebende Menschen) können sich funktionelle Lebensmittel eignen. Funktionelle Lebensmittel können helfen, die Nährstoffaufnahme zu verbessern, indem sie in ein ausgewogenes Ernährungsmuster integriert werden. Ein ausgewogenes Ernährungsmuster können sie jedoch nicht ersetzen. Ein Proteinriegel beispielsweise stellt keinen adäquaten Ersatz einer ausgewogenen Mahlzeit dar.

Belohnung mit Essen – sinnvoll oder gefährlich?
Viele Eltern belohnen ihre Kinder mit Essen, da auch sie in ihrer Kindheit mit Essen belohnt wurden. Essen ist einfach verfügbar und funktioniert wunderbar als „Verstärker“, um ein gewünschtes Verhalten zu fördern: „Iss noch drei Löffel, dann bekommst du einen Keks.“ „Wenn du jetzt artig bist, dann gibt es später Eis." Das Problem: Hierdurch wird Essen zur „Währung“ und nicht zum Ausdruck von Hunger oder Genuss. Risiken & Auswirkungen Die Verknüpfung von Essen mit Emotionen Wird mit Essen belohnt, erhöht sich das Risiko, dass das Kind unterbewusst das Essverhalten mit Emotionen verbindet. Das Kind verknüpft Gefühle wie Freude, Belohnung oder Trost beispielsweise mit dem Konsum von süßem Essen. Im späteren Leben greift das Kind in Stresssituationen dann automatisch zu Süßem, auch ohne Hunger. Beispiel: Ein Kind bekommt nach einem Arztbesuch zur Beruhigung und gleichzeitig zur Belohnung Gummibärchen. Im Erwachsenenalter tröstet es sich nach einem stressigen Tag mit Süßem. Gesunde Lebensmittel werden als „Pflicht“ empfunden Neben der emotionalen Verknüpfung kann es dazu führen, dass gesundes Essen als „Pflicht“ und ungesundes Essen als „Belohnung“ angesehen wird. Wird der Gemüseverzehr als „Hindernis“ und das süße Teilchen als „Belohnung“ wahrgenommen, kann sich eine Abneigung gegen gesunde Lebensmitteln entwickeln. Zeitgleich wird das Lebensmittel, das als Belohnung verwendet wird, für Kinder begehrenswerter. Studien zeigen, dass Kinder dazu neigen, von diesen Lebensmitteln (wenn sie frei verfügbar sind) zu viel zu essen. Beispiel: Dem Kind wird gesagt, dass es später einen Pudding bekommt, wenn es zunächst Brokkoli isst. Hierdurch ist es möglich, dass das Kind Brokkoli langfristig mit etwas Negativem und Pudding mit etwas Positivem, Begehrenswerten verbinden wird. Alternativen zur Belohnung mit Essen Anstatt das Kind mit Essen zu belohnen, kann es beispielsweise mit zusätzlicher gemeinsamer Zeit belohnt werden, indem z.B. das Lieblingsspiel gemeinsam gespielt wird. Zudem können unter anderem Sticker als kleine Auszeichnungen verliehen werden. Dient das süße Teilchen der Anregung mehr Gemüse zu essen, da das Kind ansonsten nur wenig Gemüse isst, ist es sinnvoller, das Kind bei der gemeinsamen Essensplanung einzubeziehen. Dem Kind werden z.B. verschiedene Gemüse- und Obstsorten angeboten, aus denen gemeinsam verschiedene Formen (z.B. Tierform, Baggerform, …) ausgestochen oder bunte Spieße zubereitet werden, um das Gemüse/Obst attraktiver zu gestalten. Fazit Essen sollte kein Werkzeug zur Belohnung oder Bestrafung sein, sondern Freude bereiten und Bedürfnisse stillen. Wer sein Kind nicht mit Essen, sondern Alternativen belohnt, stärkt das gesunde Essverhalten seines Kindes langfristig. Quelle: Fedewa AL, Davis MC (2015): How Food as a Reward Is Detrimental to Children's Health, Learning, and Behavior. J Sch Health; 85(9):648-58
Belohnung mit Essen – sinnvoll oder gefährlich?
Viele Eltern belohnen ihre Kinder mit Essen, da auch sie in ihrer Kindheit mit Essen belohnt wurden. Essen ist einfach verfügbar und funktioniert wunderbar als „Verstärker“, um ein gewünschtes Verhalten zu fördern: „Iss noch drei Löffel, dann bekommst du einen Keks.“ „Wenn du jetzt artig bist, dann gibt es später Eis." Das Problem: Hierdurch wird Essen zur „Währung“ und nicht zum Ausdruck von Hunger oder Genuss. Risiken & Auswirkungen Die Verknüpfung von Essen mit Emotionen Wird mit Essen belohnt, erhöht sich das Risiko, dass das Kind unterbewusst das Essverhalten mit Emotionen verbindet. Das Kind verknüpft Gefühle wie Freude, Belohnung oder Trost beispielsweise mit dem Konsum von süßem Essen. Im späteren Leben greift das Kind in Stresssituationen dann automatisch zu Süßem, auch ohne Hunger. Beispiel: Ein Kind bekommt nach einem Arztbesuch zur Beruhigung und gleichzeitig zur Belohnung Gummibärchen. Im Erwachsenenalter tröstet es sich nach einem stressigen Tag mit Süßem. Gesunde Lebensmittel werden als „Pflicht“ empfunden Neben der emotionalen Verknüpfung kann es dazu führen, dass gesundes Essen als „Pflicht“ und ungesundes Essen als „Belohnung“ angesehen wird. Wird der Gemüseverzehr als „Hindernis“ und das süße Teilchen als „Belohnung“ wahrgenommen, kann sich eine Abneigung gegen gesunde Lebensmitteln entwickeln. Zeitgleich wird das Lebensmittel, das als Belohnung verwendet wird, für Kinder begehrenswerter. Studien zeigen, dass Kinder dazu neigen, von diesen Lebensmitteln (wenn sie frei verfügbar sind) zu viel zu essen. Beispiel: Dem Kind wird gesagt, dass es später einen Pudding bekommt, wenn es zunächst Brokkoli isst. Hierdurch ist es möglich, dass das Kind Brokkoli langfristig mit etwas Negativem und Pudding mit etwas Positivem, Begehrenswerten verbinden wird. Alternativen zur Belohnung mit Essen Anstatt das Kind mit Essen zu belohnen, kann es beispielsweise mit zusätzlicher gemeinsamer Zeit belohnt werden, indem z.B. das Lieblingsspiel gemeinsam gespielt wird. Zudem können unter anderem Sticker als kleine Auszeichnungen verliehen werden. Dient das süße Teilchen der Anregung mehr Gemüse zu essen, da das Kind ansonsten nur wenig Gemüse isst, ist es sinnvoller, das Kind bei der gemeinsamen Essensplanung einzubeziehen. Dem Kind werden z.B. verschiedene Gemüse- und Obstsorten angeboten, aus denen gemeinsam verschiedene Formen (z.B. Tierform, Baggerform, …) ausgestochen oder bunte Spieße zubereitet werden, um das Gemüse/Obst attraktiver zu gestalten. Fazit Essen sollte kein Werkzeug zur Belohnung oder Bestrafung sein, sondern Freude bereiten und Bedürfnisse stillen. Wer sein Kind nicht mit Essen, sondern Alternativen belohnt, stärkt das gesunde Essverhalten seines Kindes langfristig. Quelle: Fedewa AL, Davis MC (2015): How Food as a Reward Is Detrimental to Children's Health, Learning, and Behavior. J Sch Health; 85(9):648-58

Leberwerte leicht erklärt
Einige Aufgaben der Leber Die Leber stellt das wichtigste Entgiftungsorgan unseres Körpers dar. Sie filtert schädliche Substanzen wie Alkohol, Medikamente, Abbauprodukte des Körpers und andere giftige Schadstoffe aus dem Blut und baut diese entweder ab oder wandelt sie in eine für den Körper ausscheidbare Form um. Darüber hinaus speichert sie Nährstoffe wie Glucose, damit der Körper in Fastenperioden (z.B. in der Nacht) nicht unterzuckert und produziert wichtige Proteine, die beispielsweise für die Blutgerinnung und das Immunsystem von großer Bedeutung sind. Die Gesundheit der Leber ist somit entscheidend für die Allgemeinheit des Menschen. Da bei einer Schädigung der Leberzellen einige Marker bzw. Leberwerte im Blut ansteigen, sollten diese im Optimalfall regelmäßig kontrolliert werden. Im Folgenden werden einige der Leberwerte näher erläutert. GGT Gamma-GT gibt unter anderem Hinweise über den Zustand der Leber und der Gallenwege. Ein hoher GGT-Wert kann z.B. auf Lebererkrankungen, einen Gallenstau, eine Entzündung der Gallenblase sowie Alkoholmissbrauch hinweisen. GOT Dieser Wert zeigt an, ob Schädigungen der Leber oder der Muskulatur wie z.B. des Herzmuskels vorliegen. Ein hoher GOT-Wert kann somit neben einer Lebererkrankung auch auf muskuläre Erkrankungen oder einen Herzinfarkt hinweisen. GPT GPT ist leberspezifisch und hilft somit, Leberschädigungen gezielt zu erkennen. Er ist bereits bei leichten Leberschäden erhöht und stellt daher einen sehr guten Lebermarker dar. Bilirubin Bilirubin ist ein Abbaustoff, der entsteht, wenn rote Blutkörperchen abgebaut werden. Normalerweise wird Bilirubin von der Leber abgebaut und mit dem Stuhl ausgeschieden. Kann die Leber dieser Aufgabe nicht mehr ausreichend nachgehen, steigt der Bilirubinwert im Blut an und kann zu Gelbsucht führen. Alkalische Phosphatase (AP) Die alkalische Phosphatase kann Aufschluss über die Gallenwege und Knochen geben. Ein erhöhter Wert kann somit auf eine Blockade der Gallenwege oder eine Knochenerkrankung hinweisen. Quick-Wert (INR) Der Quick-Wert zeigt, wie gut das Blut gerinnt. Bei Leberschädigung kann dieser Wert außerhalb der Norm liegen Quellen: Krämer L, Sarrazin C (2025): Diagnostik und Therapie bei Lebererkrankungen. In: VFED (2025): Leber- und Gallenwegserkrankungen in der Ernährungsberatung Deutsche Leberstiftung (2024): Leberwerte – ein einfacher Bluttest gibt erste Hinweise.
Leberwerte leicht erklärt
Einige Aufgaben der Leber Die Leber stellt das wichtigste Entgiftungsorgan unseres Körpers dar. Sie filtert schädliche Substanzen wie Alkohol, Medikamente, Abbauprodukte des Körpers und andere giftige Schadstoffe aus dem Blut und baut diese entweder ab oder wandelt sie in eine für den Körper ausscheidbare Form um. Darüber hinaus speichert sie Nährstoffe wie Glucose, damit der Körper in Fastenperioden (z.B. in der Nacht) nicht unterzuckert und produziert wichtige Proteine, die beispielsweise für die Blutgerinnung und das Immunsystem von großer Bedeutung sind. Die Gesundheit der Leber ist somit entscheidend für die Allgemeinheit des Menschen. Da bei einer Schädigung der Leberzellen einige Marker bzw. Leberwerte im Blut ansteigen, sollten diese im Optimalfall regelmäßig kontrolliert werden. Im Folgenden werden einige der Leberwerte näher erläutert. GGT Gamma-GT gibt unter anderem Hinweise über den Zustand der Leber und der Gallenwege. Ein hoher GGT-Wert kann z.B. auf Lebererkrankungen, einen Gallenstau, eine Entzündung der Gallenblase sowie Alkoholmissbrauch hinweisen. GOT Dieser Wert zeigt an, ob Schädigungen der Leber oder der Muskulatur wie z.B. des Herzmuskels vorliegen. Ein hoher GOT-Wert kann somit neben einer Lebererkrankung auch auf muskuläre Erkrankungen oder einen Herzinfarkt hinweisen. GPT GPT ist leberspezifisch und hilft somit, Leberschädigungen gezielt zu erkennen. Er ist bereits bei leichten Leberschäden erhöht und stellt daher einen sehr guten Lebermarker dar. Bilirubin Bilirubin ist ein Abbaustoff, der entsteht, wenn rote Blutkörperchen abgebaut werden. Normalerweise wird Bilirubin von der Leber abgebaut und mit dem Stuhl ausgeschieden. Kann die Leber dieser Aufgabe nicht mehr ausreichend nachgehen, steigt der Bilirubinwert im Blut an und kann zu Gelbsucht führen. Alkalische Phosphatase (AP) Die alkalische Phosphatase kann Aufschluss über die Gallenwege und Knochen geben. Ein erhöhter Wert kann somit auf eine Blockade der Gallenwege oder eine Knochenerkrankung hinweisen. Quick-Wert (INR) Der Quick-Wert zeigt, wie gut das Blut gerinnt. Bei Leberschädigung kann dieser Wert außerhalb der Norm liegen Quellen: Krämer L, Sarrazin C (2025): Diagnostik und Therapie bei Lebererkrankungen. In: VFED (2025): Leber- und Gallenwegserkrankungen in der Ernährungsberatung Deutsche Leberstiftung (2024): Leberwerte – ein einfacher Bluttest gibt erste Hinweise.

Mitochondriopathien
Was sind Mitochondrien? Mitochondrien sind unsere „Kraftwerke der Zellen“. Sie produzieren (in der sogenannten Atmungskette) Energie, die für sämtliche körperliche Prozesse und somit das Leben benötigt wird. Fast jede Zelle enthält einige hundert bis mehrere tausend Mitochondrien. Wie viele Mitochondrien sie enthalten, hängt davon ab, wie viel Energie die jeweilige Zelle benötigt. In welchen Zellen sind die meisten Mitochondrien zu finden? Zellen des Herzens bzw. der Muskulatur im Allgemeinen und Nervenzellen enthalten (im Vergleich zu manch anderen Zellen) auf Grund des erhöhten Energieverbrauchs eine größere Menge an Mitochondrien. Eizellen enthalten bis zu 100.000 Mitochondrien pro Zelle. Was passiert, wenn die Mitochondrien nicht mehr richtig arbeiten? Funktioniert die Atmungskette nicht mehr, wie sie eigentlich sollte, da eine mitochondriale Erkrankung vorliegt, wird zu wenig Energie produziert. Diese Funktionsstörungen führen nicht selten zu erheblichen Einbußen der Lebensqualität. Zusammengefasst werden diese Funktionsstörungen unter dem Begriff „Mitochondriopathien“. Mitochondriopathien können zum einen genetisch veranlagt sein, wodurch sich bereits in der Kindheit Symptome zeigen oder aber im Laufe des Lebens erworben werden. Erworbene Mitochondriopathien können durch äußere Einflüsse wie chronischem Stress, Toxine, Bewegungsmangel, einer ungesunden Ernährung, oxidativen und nitrosativen Stress (Rauchen, Alkohol, Strahlung, …) entstehen. Sie führen zu einer Schädigung der Mitochondrien. Übrigens: Mit zunehmendem Alter nimmt die Leistung der Mitochondrien natürlicherweise ab. Mögliche Folgen von Mitochondriopathien Mitochondriale Funktionsstörungen können zu verschiedensten Erkrankungen führen. Im Folgenden werden einige aufgelistet: neurologische Erkrankungen (Parkinson, Alzheimer, Multiple Sklerose, …) Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörungen, …) Stoffwechselstörungen (Diabetes mellitus Typ 2, Metabolisches Syndrom) Muskelerkrankungen (Kraftverlust und Muskelschwäche) Störungen des Immunsystems (Autoimmunerkrankungen, chronische Entzündungen) Fatigue Syndrom (chronische Erschöpfung und Müdigkeit) Störungen der Fruchtbarkeit (Unfruchtbarkeit, Schwangerschaftskomplikationen) Nährstoffe für die Energiegewinnung Für eine reibungslose Energiegewinnung sind unter anderem folgende Nährstoffe entscheidend: B-Vitamine Coenzym Q10 Magnesium Eisen Selen Zink Vitamin D Alpha-Liponsäure L-Carnitin Quellen: Mantle D, Hargreaves IP (2022): Mitochondrial Dysfunction and Neurodegenerative Disorders: Role of Nutritional Supplementation. Int J Mol Sci, 23(20):12603 Fila M, Chojnacki C, Chojnacki J, Blasiak J (2021): Nutrients to Improve Mitochondrial Function to Reduce Brain Energy Deficit and Oxidative Stress in Migraine. Nutrients, 13(12):4433 Schütz B, Hoos C (2022): Mitochondrien – Impulsgeber für eine bessere Therapie. In: OM & Ernährung, SH24
Mitochondriopathien
Was sind Mitochondrien? Mitochondrien sind unsere „Kraftwerke der Zellen“. Sie produzieren (in der sogenannten Atmungskette) Energie, die für sämtliche körperliche Prozesse und somit das Leben benötigt wird. Fast jede Zelle enthält einige hundert bis mehrere tausend Mitochondrien. Wie viele Mitochondrien sie enthalten, hängt davon ab, wie viel Energie die jeweilige Zelle benötigt. In welchen Zellen sind die meisten Mitochondrien zu finden? Zellen des Herzens bzw. der Muskulatur im Allgemeinen und Nervenzellen enthalten (im Vergleich zu manch anderen Zellen) auf Grund des erhöhten Energieverbrauchs eine größere Menge an Mitochondrien. Eizellen enthalten bis zu 100.000 Mitochondrien pro Zelle. Was passiert, wenn die Mitochondrien nicht mehr richtig arbeiten? Funktioniert die Atmungskette nicht mehr, wie sie eigentlich sollte, da eine mitochondriale Erkrankung vorliegt, wird zu wenig Energie produziert. Diese Funktionsstörungen führen nicht selten zu erheblichen Einbußen der Lebensqualität. Zusammengefasst werden diese Funktionsstörungen unter dem Begriff „Mitochondriopathien“. Mitochondriopathien können zum einen genetisch veranlagt sein, wodurch sich bereits in der Kindheit Symptome zeigen oder aber im Laufe des Lebens erworben werden. Erworbene Mitochondriopathien können durch äußere Einflüsse wie chronischem Stress, Toxine, Bewegungsmangel, einer ungesunden Ernährung, oxidativen und nitrosativen Stress (Rauchen, Alkohol, Strahlung, …) entstehen. Sie führen zu einer Schädigung der Mitochondrien. Übrigens: Mit zunehmendem Alter nimmt die Leistung der Mitochondrien natürlicherweise ab. Mögliche Folgen von Mitochondriopathien Mitochondriale Funktionsstörungen können zu verschiedensten Erkrankungen führen. Im Folgenden werden einige aufgelistet: neurologische Erkrankungen (Parkinson, Alzheimer, Multiple Sklerose, …) Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörungen, …) Stoffwechselstörungen (Diabetes mellitus Typ 2, Metabolisches Syndrom) Muskelerkrankungen (Kraftverlust und Muskelschwäche) Störungen des Immunsystems (Autoimmunerkrankungen, chronische Entzündungen) Fatigue Syndrom (chronische Erschöpfung und Müdigkeit) Störungen der Fruchtbarkeit (Unfruchtbarkeit, Schwangerschaftskomplikationen) Nährstoffe für die Energiegewinnung Für eine reibungslose Energiegewinnung sind unter anderem folgende Nährstoffe entscheidend: B-Vitamine Coenzym Q10 Magnesium Eisen Selen Zink Vitamin D Alpha-Liponsäure L-Carnitin Quellen: Mantle D, Hargreaves IP (2022): Mitochondrial Dysfunction and Neurodegenerative Disorders: Role of Nutritional Supplementation. Int J Mol Sci, 23(20):12603 Fila M, Chojnacki C, Chojnacki J, Blasiak J (2021): Nutrients to Improve Mitochondrial Function to Reduce Brain Energy Deficit and Oxidative Stress in Migraine. Nutrients, 13(12):4433 Schütz B, Hoos C (2022): Mitochondrien – Impulsgeber für eine bessere Therapie. In: OM & Ernährung, SH24

PCOS – Die Diagnose ist keine Endstation
Was ist PCOS? Beim Polyzystischen Ovarialsyndrom (PCOS) handelt es sich um eine Stoffwechsel- und Fortpflanzungsstörung, die ausschließlich Frauen betreffen kann. Symptome sind unter anderem ein gestörter Menstruationszyklus (Zyklen länger als 35 Tage oder kürzer als 21 Tage), eine ausbleibende Menstruation, eine verstärkte Körperbehaarung oder Haarausfall. Letztere beiden kommen durch einen Überschuss an männlichen Hormonen zustande. Je nachdem wie das Krankheitsbild definiert wird und welche Phänotypen bei der Diagnostik einbezogen werden, liegt die weltweite Prävalenz von PCOS zwischen 4 und 21 %. Knapp 60-70 % der Frauen mit PCOS sind übergewichtig. PCOS muss jedoch nicht zwingend mit Übergewicht einherkommen, denn auch Normalgewichtige können an PCOS erkranken. Einen großen Faktor bei der Erkrankung spielt die Insulinresistenz. Eine Studie konnte bei 75 % der normalgewichtigen und 95 % der übergewichtigen Frauen mit PCOS eine Insulinresistenz feststellen. Was sind die Ursachen der Entwicklung von PCOS? Die genauen Ursachen für die Entwicklung des Syndroms sind noch nicht vollständig geklärt. Vermutlich spielen genetische Faktoren eine Rolle. Ob zuerst eine Insulinresistenz vorliegt und dann PCOS ausbricht oder ob das Syndrom von den Eierstöcken ausgeht, ist noch nicht klar. Zeitgleich kommt es zu einer vermehrten Ausschüttung des Luteinisierenden Hormons (LH) in der Hypophyse. Übergewicht, insbesondere die Anhäufung von viszeralem Fettgewebe („Bauchfett“) kann durch die Produktion von Hormonen ebenfalls zum Hormonungleichgewicht beitragen. Was sind mögliche Folgen von PCOS? Durch die erhöhte Insulinausschüttung kann die Produktion von männlichen Hormonen und LH weiter steigen. Das wiederum fördert die Entwicklung von Diabetes mellitus Typ 2 und einer nicht alkoholischen Fettleber (MASLD). Darüber hinaus liegt ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Angstzustände und Depressionen vor. Bei einer Schwangerschaft ist das Risiko für Schwangerschaftsdiabetes und Präeklampsie erhöht. Wie wird PCOS diagnostiziert? In Deutschland wird PCOS in der Regel nach den Rotterdam Kriterien diagnostiziert. Hierbei werden verschiedene Symptome abgefragt bzw. untersucht. Es werden Erkrankungen, die ein ähnliches Erscheinungsbild haben, ausgeschlossen. Zudem müssen zwei der drei folgenden Kriterien erfüllt sein: Es liegt ein Überschuss an männlichen Hormonen im Blut oder ein vermehrter Haarwuchs an für Frauen untypischen Körperregionen Es liegt ein gestörter Menstruationszyklus oder eine ausbleibende Periode vor Im Ultraschall lassen sich mehr als 20 mit Flüssigkeit gefüllte Follikel an einem oder beiden Eierstöcken finden oder es liegt ein ovarielles Volumen eines Eierstocks von > 10 ml vor Was tun nach einer PCOS-Diagnose? Liegt eine Insulinresistenz vor, sollte das Ziel sein, die Insulinsensitivität zu steigern. Dies kann erreicht werden, indem die täglichen Bewegungsumfänge gesteigert und regelmäßige Sporteinheiten in Form von Krafttraining durchgeführt werden. Zudem sollte das Ernährungsmuster angepasst werden. Hierfür lohnt es sich, Hilfe bei einer Ernährungsfachkraft wie einer Ökotrophologin, Diätassistentin oder Ernährungswissenschaftlerin in Anspruch zu nehmen. Die Einnahme von Medikamenten wie Metformin sollte individuell abgewogen werden. Zudem kann individuell unter anderem die Einnahme von Myo-Inositol getestet werden. Auch Nährstoffe wie beispielsweise Vitamin D, marine Omega-3-Fettsäuren (EPA, DHA) sowie NAC können individuell eingesetzt werden. Quellen: Lizneva D, Suturina L, Walker W, Brakta S, Gavrilova-Jordan L, Azziz R (2016): Criteria, prevalence, and phenotypes of polycystic ovary syndrome. Fertil Steril, 106(1):6-15 Chang S, Dunaif A (2021): Diagnosis of Polycystic Ovary Syndrome: Which Criteria to Use and When? Endocrinol Metab Clin North Am, 50(1):11-23 Greff D, Juhász AE, Váncsa S, Váradi A, Sipos Z, Szinte J, Park S, Hegyi P, Nyirády P, Ács N, Várbíró S, Horváth EM (2023): Inositol is an effective and safe treatment in polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Reprod Biol Endocrinol, 21(1):10 Teede HJ, Tay CT, Laven JJE, Dokras A, Moran LJ, Piltonen TT, Costello MF, Boivin J, Redman LM, Boyle JA, Norman RJ, Mousa A, Joham AE (2023): Recommendations From the 2023 International Evidence-based Guideline for the Assessment and Management of Polycystic Ovary Syndrome. J Clin Endocrinol Metab, 108(10):2447-2469 Alesi S, Ee C, Moran LJ, Rao V, Mousa A (2022): Nutritional Supplements and Complementary Therapies in Polycystic Ovary Syndrome. Adv Nutr, 13(4):1243-1266
PCOS – Die Diagnose ist keine Endstation
Was ist PCOS? Beim Polyzystischen Ovarialsyndrom (PCOS) handelt es sich um eine Stoffwechsel- und Fortpflanzungsstörung, die ausschließlich Frauen betreffen kann. Symptome sind unter anderem ein gestörter Menstruationszyklus (Zyklen länger als 35 Tage oder kürzer als 21 Tage), eine ausbleibende Menstruation, eine verstärkte Körperbehaarung oder Haarausfall. Letztere beiden kommen durch einen Überschuss an männlichen Hormonen zustande. Je nachdem wie das Krankheitsbild definiert wird und welche Phänotypen bei der Diagnostik einbezogen werden, liegt die weltweite Prävalenz von PCOS zwischen 4 und 21 %. Knapp 60-70 % der Frauen mit PCOS sind übergewichtig. PCOS muss jedoch nicht zwingend mit Übergewicht einherkommen, denn auch Normalgewichtige können an PCOS erkranken. Einen großen Faktor bei der Erkrankung spielt die Insulinresistenz. Eine Studie konnte bei 75 % der normalgewichtigen und 95 % der übergewichtigen Frauen mit PCOS eine Insulinresistenz feststellen. Was sind die Ursachen der Entwicklung von PCOS? Die genauen Ursachen für die Entwicklung des Syndroms sind noch nicht vollständig geklärt. Vermutlich spielen genetische Faktoren eine Rolle. Ob zuerst eine Insulinresistenz vorliegt und dann PCOS ausbricht oder ob das Syndrom von den Eierstöcken ausgeht, ist noch nicht klar. Zeitgleich kommt es zu einer vermehrten Ausschüttung des Luteinisierenden Hormons (LH) in der Hypophyse. Übergewicht, insbesondere die Anhäufung von viszeralem Fettgewebe („Bauchfett“) kann durch die Produktion von Hormonen ebenfalls zum Hormonungleichgewicht beitragen. Was sind mögliche Folgen von PCOS? Durch die erhöhte Insulinausschüttung kann die Produktion von männlichen Hormonen und LH weiter steigen. Das wiederum fördert die Entwicklung von Diabetes mellitus Typ 2 und einer nicht alkoholischen Fettleber (MASLD). Darüber hinaus liegt ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Angstzustände und Depressionen vor. Bei einer Schwangerschaft ist das Risiko für Schwangerschaftsdiabetes und Präeklampsie erhöht. Wie wird PCOS diagnostiziert? In Deutschland wird PCOS in der Regel nach den Rotterdam Kriterien diagnostiziert. Hierbei werden verschiedene Symptome abgefragt bzw. untersucht. Es werden Erkrankungen, die ein ähnliches Erscheinungsbild haben, ausgeschlossen. Zudem müssen zwei der drei folgenden Kriterien erfüllt sein: Es liegt ein Überschuss an männlichen Hormonen im Blut oder ein vermehrter Haarwuchs an für Frauen untypischen Körperregionen Es liegt ein gestörter Menstruationszyklus oder eine ausbleibende Periode vor Im Ultraschall lassen sich mehr als 20 mit Flüssigkeit gefüllte Follikel an einem oder beiden Eierstöcken finden oder es liegt ein ovarielles Volumen eines Eierstocks von > 10 ml vor Was tun nach einer PCOS-Diagnose? Liegt eine Insulinresistenz vor, sollte das Ziel sein, die Insulinsensitivität zu steigern. Dies kann erreicht werden, indem die täglichen Bewegungsumfänge gesteigert und regelmäßige Sporteinheiten in Form von Krafttraining durchgeführt werden. Zudem sollte das Ernährungsmuster angepasst werden. Hierfür lohnt es sich, Hilfe bei einer Ernährungsfachkraft wie einer Ökotrophologin, Diätassistentin oder Ernährungswissenschaftlerin in Anspruch zu nehmen. Die Einnahme von Medikamenten wie Metformin sollte individuell abgewogen werden. Zudem kann individuell unter anderem die Einnahme von Myo-Inositol getestet werden. Auch Nährstoffe wie beispielsweise Vitamin D, marine Omega-3-Fettsäuren (EPA, DHA) sowie NAC können individuell eingesetzt werden. Quellen: Lizneva D, Suturina L, Walker W, Brakta S, Gavrilova-Jordan L, Azziz R (2016): Criteria, prevalence, and phenotypes of polycystic ovary syndrome. Fertil Steril, 106(1):6-15 Chang S, Dunaif A (2021): Diagnosis of Polycystic Ovary Syndrome: Which Criteria to Use and When? Endocrinol Metab Clin North Am, 50(1):11-23 Greff D, Juhász AE, Váncsa S, Váradi A, Sipos Z, Szinte J, Park S, Hegyi P, Nyirády P, Ács N, Várbíró S, Horváth EM (2023): Inositol is an effective and safe treatment in polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Reprod Biol Endocrinol, 21(1):10 Teede HJ, Tay CT, Laven JJE, Dokras A, Moran LJ, Piltonen TT, Costello MF, Boivin J, Redman LM, Boyle JA, Norman RJ, Mousa A, Joham AE (2023): Recommendations From the 2023 International Evidence-based Guideline for the Assessment and Management of Polycystic Ovary Syndrome. J Clin Endocrinol Metab, 108(10):2447-2469 Alesi S, Ee C, Moran LJ, Rao V, Mousa A (2022): Nutritional Supplements and Complementary Therapies in Polycystic Ovary Syndrome. Adv Nutr, 13(4):1243-1266

Wie du dein Nervensystem beeinflussen kannst
Aus was besteht das vegetative Nervensystem? Das vegetative Nervensystem besteht unter anderem aus den beiden Systemen „Sympathikus“ und „Parasympathikus“. Sie steuern unbewusst lebenswichtige Funktionen wie beispielsweise die Verdauung, die Atmung, Abläufe im Magen-Darm-Trakt, die Körpertemperatur und Funktionen des Kreislaufs. Da diese Vorgänge vom Menschen willentlich nicht direkt, allenfalls indirekt beeinflusst werden können, wird das Nervensystem auch „autonomes Nervensystem“ genannt. Sympathikus Der Sympathikus auch als „Flight or Fight-Modus“ (Fliehe oder Kämpfe) bekannt, weitet die Pupillen und die Bronchien, erhöht die Herzschlagfrequenz, steigert die Konzentration, verbessert die Durchblutung der Skelettmuskulatur und hemmt die Tätigkeit der Verdauungsorgane (Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse, Gallenblase). Dieser Modus lässt den Menschen leistungsfähig in „Gefahrensituationen“ bzw. akuten Stresssituationen werden. Parasympathikus Der Parasympathikus wird als „Gegenstück“ zum Sympathikus betrachtet. Dieses Nervensystem wird auch als „Rest and Digest“ (Entspannung und Verdauung) bezeichnet. Er verengt die Pupillen und die Bronchien, senkt die Herzschlagfrequenz und stimuliert die Tätigkeit der Verdauungsorgane. Ist dieses Nervensystem vorrangig aktiv, befindet sich der Mensch in einem Zustand der Entspannung. Die Mischung macht‘s Akuter Stress und damit die Aktivierung des Sympathikus ist nicht zwingend negativ zu bewerten. Wichtig ist, dass der Stress nach einer gewissen Zeit wieder abflacht und sich nicht chronifiziert. Das Ziel sollte es somit nicht sein, ein Leben in voller „Entspannung“ zu leben, sondern vielmehr eine Balance zwischen Anspannung und Entspannung herzustellen. Da Stress und somit „Anspannung“ allgegenwärtig ist, sollte der Fokus auf die Aktivierung des Parasympathikus gelegt werden. Wie kann der Parasympathikus „aktiviert“ werden? Der Parasympathikus kann durch Aktivitäten wie z.B. der Durchführung von Atemtechniken und somit einem tiefen Atem „aktiviert“ werden. Auch Praktiken wie die Durchführung einer Meditation, die Integration von autogenem Training oder Qigong können helfen, in einen Zustand der Entspannung zu gelangen. Quellen: Schmidt RF, Schaible HF (Hrsg) (2001): Neuro- und Sinnesphysiologie. 4. Auflage, Springer Verlag Gibbons CH (2019): Basics of autonomic nervous system function. Handb Clin Neurol, 160:407-418 Benarroch EE (2020): Physiology and Pathophysiology of the Autonomic Nervous System. Continuum (Minneap Minn), 26(1):12-24
Wie du dein Nervensystem beeinflussen kannst
Aus was besteht das vegetative Nervensystem? Das vegetative Nervensystem besteht unter anderem aus den beiden Systemen „Sympathikus“ und „Parasympathikus“. Sie steuern unbewusst lebenswichtige Funktionen wie beispielsweise die Verdauung, die Atmung, Abläufe im Magen-Darm-Trakt, die Körpertemperatur und Funktionen des Kreislaufs. Da diese Vorgänge vom Menschen willentlich nicht direkt, allenfalls indirekt beeinflusst werden können, wird das Nervensystem auch „autonomes Nervensystem“ genannt. Sympathikus Der Sympathikus auch als „Flight or Fight-Modus“ (Fliehe oder Kämpfe) bekannt, weitet die Pupillen und die Bronchien, erhöht die Herzschlagfrequenz, steigert die Konzentration, verbessert die Durchblutung der Skelettmuskulatur und hemmt die Tätigkeit der Verdauungsorgane (Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse, Gallenblase). Dieser Modus lässt den Menschen leistungsfähig in „Gefahrensituationen“ bzw. akuten Stresssituationen werden. Parasympathikus Der Parasympathikus wird als „Gegenstück“ zum Sympathikus betrachtet. Dieses Nervensystem wird auch als „Rest and Digest“ (Entspannung und Verdauung) bezeichnet. Er verengt die Pupillen und die Bronchien, senkt die Herzschlagfrequenz und stimuliert die Tätigkeit der Verdauungsorgane. Ist dieses Nervensystem vorrangig aktiv, befindet sich der Mensch in einem Zustand der Entspannung. Die Mischung macht‘s Akuter Stress und damit die Aktivierung des Sympathikus ist nicht zwingend negativ zu bewerten. Wichtig ist, dass der Stress nach einer gewissen Zeit wieder abflacht und sich nicht chronifiziert. Das Ziel sollte es somit nicht sein, ein Leben in voller „Entspannung“ zu leben, sondern vielmehr eine Balance zwischen Anspannung und Entspannung herzustellen. Da Stress und somit „Anspannung“ allgegenwärtig ist, sollte der Fokus auf die Aktivierung des Parasympathikus gelegt werden. Wie kann der Parasympathikus „aktiviert“ werden? Der Parasympathikus kann durch Aktivitäten wie z.B. der Durchführung von Atemtechniken und somit einem tiefen Atem „aktiviert“ werden. Auch Praktiken wie die Durchführung einer Meditation, die Integration von autogenem Training oder Qigong können helfen, in einen Zustand der Entspannung zu gelangen. Quellen: Schmidt RF, Schaible HF (Hrsg) (2001): Neuro- und Sinnesphysiologie. 4. Auflage, Springer Verlag Gibbons CH (2019): Basics of autonomic nervous system function. Handb Clin Neurol, 160:407-418 Benarroch EE (2020): Physiology and Pathophysiology of the Autonomic Nervous System. Continuum (Minneap Minn), 26(1):12-24

Omas Kartoffelsalat – das Beste, das deinem Darm passieren kann?
Omas Kartoffelsalat schmeckt nicht nur hervorragend – nein, er kann sich darüber hinaus positiv auf deine Darmgesundheit auswirken! Du fragst dich, wie das funktionieren soll? Ganz einfach: Was sind Ballaststoffe? Ballaststoffe sind weitgehend unverdauliche Faserstoffe, die vorwiegend in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten sind. Darum sollten sie Teil deiner täglichen Ernährung sein Ballaststoffe sind kein Ballast für den Körper – im Gegenteil: Sie können sich positiv auf die Verdauung auswirken, indem sie die Verweildauer der Nahrung im Darm verkürzen, die Häufigkeit der Darmentleerung erhöhen und die Konsistenz des Stuhls verbessern. Darüber hinaus tragen sie zu einer längeren Sättigung bei und weisen eine so genannte präbiotische Wirkung auf. Letzteres bedeutet, dass sie unter anderem den für uns sehr nützlichen Darmbakterien wie Bifidobakterien und Laktobazillen als Nahrung dienen. Was hat das mit der Darmgesundheit zu tun? Sobald die Darmbakterien die aufgenommenen Ballaststoffe verstoffwechseln, entstehen sogenannte kurzkettige Fettsäuren. Kurzkettige Fettsäuren wirken zum einen lokal im Darm, indem sie beispielsweise den pH-Wert senken und so das Risiko für Dickdarmkrebs reduzieren, zum anderen werden sie in die Blutlaufbahn aufgenommen, wodurch sie ihre entzündungs regulierenden Eigenschaften im gesamten Organismus entfalten können. Warum nun Kartoffelsalat? Sobald gekochte Kartoffeln für mindestens 24 Stunden abkühlen, entsteht eine resistente Stärke. Resistente Stärke kann von unserem Körper nicht verdaut werden. Sie zählt zu den Ballaststoffen und dient den Darmbakterien somit als Nahrung. Der Kartoffelsalat deiner Oma kann somit eine gute Möglichkeit darstellen, deine Ballaststoffaufnahme zu steigern und damit deine Darmgesundheit zu fördern. Quelle: Jung DH, Park CS (2023): Resistant starch utilization by Bifidobacterium, the beneficial human gut bacteria. Food Sci Biotechnol; 32(4):441-452
Omas Kartoffelsalat – das Beste, das deinem Darm passieren kann?
Omas Kartoffelsalat schmeckt nicht nur hervorragend – nein, er kann sich darüber hinaus positiv auf deine Darmgesundheit auswirken! Du fragst dich, wie das funktionieren soll? Ganz einfach: Was sind Ballaststoffe? Ballaststoffe sind weitgehend unverdauliche Faserstoffe, die vorwiegend in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten sind. Darum sollten sie Teil deiner täglichen Ernährung sein Ballaststoffe sind kein Ballast für den Körper – im Gegenteil: Sie können sich positiv auf die Verdauung auswirken, indem sie die Verweildauer der Nahrung im Darm verkürzen, die Häufigkeit der Darmentleerung erhöhen und die Konsistenz des Stuhls verbessern. Darüber hinaus tragen sie zu einer längeren Sättigung bei und weisen eine so genannte präbiotische Wirkung auf. Letzteres bedeutet, dass sie unter anderem den für uns sehr nützlichen Darmbakterien wie Bifidobakterien und Laktobazillen als Nahrung dienen. Was hat das mit der Darmgesundheit zu tun? Sobald die Darmbakterien die aufgenommenen Ballaststoffe verstoffwechseln, entstehen sogenannte kurzkettige Fettsäuren. Kurzkettige Fettsäuren wirken zum einen lokal im Darm, indem sie beispielsweise den pH-Wert senken und so das Risiko für Dickdarmkrebs reduzieren, zum anderen werden sie in die Blutlaufbahn aufgenommen, wodurch sie ihre entzündungs regulierenden Eigenschaften im gesamten Organismus entfalten können. Warum nun Kartoffelsalat? Sobald gekochte Kartoffeln für mindestens 24 Stunden abkühlen, entsteht eine resistente Stärke. Resistente Stärke kann von unserem Körper nicht verdaut werden. Sie zählt zu den Ballaststoffen und dient den Darmbakterien somit als Nahrung. Der Kartoffelsalat deiner Oma kann somit eine gute Möglichkeit darstellen, deine Ballaststoffaufnahme zu steigern und damit deine Darmgesundheit zu fördern. Quelle: Jung DH, Park CS (2023): Resistant starch utilization by Bifidobacterium, the beneficial human gut bacteria. Food Sci Biotechnol; 32(4):441-452

Rote Bete – Gesundheits Knolle für Sportler?!
Rote Bete – mehr als nur eine erdig schmeckende Knolle? Rote Bete ist eine heimische Knolle, die nicht bei jedem Gaumen zu einer Geschmacksexplosion führt. Der Geschmack wird oftmals als „leicht erdig“ gleichzeitig, aber süßlich beschrieben. Aus gesundheitlicher Sicht ist die Rote Bete auf Grund ihrer Inhaltsstoffe vielfältig einsetzbar. Einen großen Anklang findet sie in der Sporternährung oder auch bei der Erkrankung Bluthochdruck. Warum das so ist, erfährst du im Folgenden. Rote Bete Saft im Sport Das in Rote Bete Saft enthaltene Nitrat führt zur Erhöhung der Stickstoffmonoxid-Produktion im Körper. Stickstoffmonoxid wiederum bewirkt eine Erweiterung der Blutgefäße. Dieser gefäßerweiternde Effekt erhöht den Blutfluss zu den Muskelfasern und fördert den Sauerstofftransport. Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass die Einnahme von Rote Bete Saft die Leistung bei Sportarten mit hoch intensiven, intermittierenden Belastungen im Teamsport mit einer Dauer von 12-40 Minuten steigern kann. Die Einnahme von Rote Bete Saft kann die mit hochintensiven Trainingseinheiten verbundene Muskelermüdung verringern. Vor allem untrainierte / moderat trainierte Menschen scheinen von einer Nitrat-Supplementation zu profitieren. Im Optimalfall sollte der Saft etwa 90 Minuten vor der sportlichen Aktivität eingenommen werden. Neben Nitrat enthält Rote Bete zusätzlich Nährstoffe wie Polyphenole (sekundäre Pflanzenstoffe), welche die Regeneration nach einer intensiven Trainingseinheit unterstützen können. Der Nitratgehalt in Rote Bete kann stark variieren. Aus diesem Grund solltest du Rote Bete Saft bevorzugen, auf dem der Nitratgehalt deklariert ist. Durchschnittlich sind in etwa 70 mg Nitrat pro 100 ml enthalten. Wer Nitrat in Form eines Supplements supplementiert, sollte bei einer akuten Nitrat-Supplementation in etwa 300-600 mg und bei einer chronischen Supplementation (2-3 Wochen) ca. 500 mg Nitrat einnehmen. Langfristig sollten nicht mehr als 3,7 mg Nitrat pro kg Körpergewicht am Tag supplementiert werden. Akute Nebenwirkungen einer zu hohen Nitrataufnahme können beispielsweise Magenverstimmungen und hierdurch eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit sein. Rote Bete Saft und Bluthochdruck Da Stickstoffmonoxid eine gefäßerweiternde Wirkung aufweist, könnte die Einnahme von einem Glas Rote Bete Saft in der Therapie von Bluthochdruck zum Einsatz kommen. Einige Daten deuten darauf hin, dass die tägliche Einnahme von Rote Bete Saft den systolischen Blutdruck bei Personen mit Bluthochdruck senken kann. Diesbezüglich sollten jedoch weitere Studien durchgeführt werden, um beispielsweise die Langzeiteffekte zu untersuchen. *Disclaimer: Besprich den Konsum von roter Bete Saft zunächst mit deinem behandelnden Arzt, falls du blutdrucksenkende Medikamente einnimmst. Quellen: Zoughaib WS, Fry MJ, Singhal A, Coggan AR (2024): Beetroot juice supplementation and exercise performance: is there more to the story than just nitrate? Front Nutr, 11:1347242 Domínguez R, Maté-Muñoz JL, Cuenca E, García-Fernández P, Mata-Ordoñez F, Lozano-Estevan MC, Veiga-Herreros P, da Silva SF, Garnacho-Castaño MV (2018): Effects of beetroot juice supplementation on intermittent high-intensity exercise efforts. J Int Soc Sports Nutr, 15:2 Grönroos R, Eggertsen R, Bernhardsson S, Praetorius Björk M (2024): Effects of beetroot juice on blood pressure in hypertension according to European Society of Hypertension Guidelines: A systematic review and meta-analysis. Nutr Metab Cardiovasc Dis, 34(10):2240-2256 Antonio J, Pereira F, Curtis J, Rojas J, Evans C (2024): The Top 5 Can't-Miss Sport Supplements. Nutrients, 16(19):3247 Raschka C, Ruf S (2022): Sport und Ernährung. 5. Auflage, Georg Thieme Verlag
Rote Bete – Gesundheits Knolle für Sportler?!
Rote Bete – mehr als nur eine erdig schmeckende Knolle? Rote Bete ist eine heimische Knolle, die nicht bei jedem Gaumen zu einer Geschmacksexplosion führt. Der Geschmack wird oftmals als „leicht erdig“ gleichzeitig, aber süßlich beschrieben. Aus gesundheitlicher Sicht ist die Rote Bete auf Grund ihrer Inhaltsstoffe vielfältig einsetzbar. Einen großen Anklang findet sie in der Sporternährung oder auch bei der Erkrankung Bluthochdruck. Warum das so ist, erfährst du im Folgenden. Rote Bete Saft im Sport Das in Rote Bete Saft enthaltene Nitrat führt zur Erhöhung der Stickstoffmonoxid-Produktion im Körper. Stickstoffmonoxid wiederum bewirkt eine Erweiterung der Blutgefäße. Dieser gefäßerweiternde Effekt erhöht den Blutfluss zu den Muskelfasern und fördert den Sauerstofftransport. Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass die Einnahme von Rote Bete Saft die Leistung bei Sportarten mit hoch intensiven, intermittierenden Belastungen im Teamsport mit einer Dauer von 12-40 Minuten steigern kann. Die Einnahme von Rote Bete Saft kann die mit hochintensiven Trainingseinheiten verbundene Muskelermüdung verringern. Vor allem untrainierte / moderat trainierte Menschen scheinen von einer Nitrat-Supplementation zu profitieren. Im Optimalfall sollte der Saft etwa 90 Minuten vor der sportlichen Aktivität eingenommen werden. Neben Nitrat enthält Rote Bete zusätzlich Nährstoffe wie Polyphenole (sekundäre Pflanzenstoffe), welche die Regeneration nach einer intensiven Trainingseinheit unterstützen können. Der Nitratgehalt in Rote Bete kann stark variieren. Aus diesem Grund solltest du Rote Bete Saft bevorzugen, auf dem der Nitratgehalt deklariert ist. Durchschnittlich sind in etwa 70 mg Nitrat pro 100 ml enthalten. Wer Nitrat in Form eines Supplements supplementiert, sollte bei einer akuten Nitrat-Supplementation in etwa 300-600 mg und bei einer chronischen Supplementation (2-3 Wochen) ca. 500 mg Nitrat einnehmen. Langfristig sollten nicht mehr als 3,7 mg Nitrat pro kg Körpergewicht am Tag supplementiert werden. Akute Nebenwirkungen einer zu hohen Nitrataufnahme können beispielsweise Magenverstimmungen und hierdurch eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit sein. Rote Bete Saft und Bluthochdruck Da Stickstoffmonoxid eine gefäßerweiternde Wirkung aufweist, könnte die Einnahme von einem Glas Rote Bete Saft in der Therapie von Bluthochdruck zum Einsatz kommen. Einige Daten deuten darauf hin, dass die tägliche Einnahme von Rote Bete Saft den systolischen Blutdruck bei Personen mit Bluthochdruck senken kann. Diesbezüglich sollten jedoch weitere Studien durchgeführt werden, um beispielsweise die Langzeiteffekte zu untersuchen. *Disclaimer: Besprich den Konsum von roter Bete Saft zunächst mit deinem behandelnden Arzt, falls du blutdrucksenkende Medikamente einnimmst. Quellen: Zoughaib WS, Fry MJ, Singhal A, Coggan AR (2024): Beetroot juice supplementation and exercise performance: is there more to the story than just nitrate? Front Nutr, 11:1347242 Domínguez R, Maté-Muñoz JL, Cuenca E, García-Fernández P, Mata-Ordoñez F, Lozano-Estevan MC, Veiga-Herreros P, da Silva SF, Garnacho-Castaño MV (2018): Effects of beetroot juice supplementation on intermittent high-intensity exercise efforts. J Int Soc Sports Nutr, 15:2 Grönroos R, Eggertsen R, Bernhardsson S, Praetorius Björk M (2024): Effects of beetroot juice on blood pressure in hypertension according to European Society of Hypertension Guidelines: A systematic review and meta-analysis. Nutr Metab Cardiovasc Dis, 34(10):2240-2256 Antonio J, Pereira F, Curtis J, Rojas J, Evans C (2024): The Top 5 Can't-Miss Sport Supplements. Nutrients, 16(19):3247 Raschka C, Ruf S (2022): Sport und Ernährung. 5. Auflage, Georg Thieme Verlag

Die fünf Säulen der Gesundheit
Deine Gesundheit ist dein Tempel Stelle dir deine Gesundheit wie einen Tempel vor, dessen prachtvolles Dach durch fünf Säulen getragen wird. Diese fünf Säulen sind zwar aus robusten Steinen erbaut, erlangen über die Jahre hinweg (durch beispielsweise Umweltfaktoren) jedoch kleine Risse, die sich, wenn sie nicht restauriert werden, zu immer größeren Rissen entwickeln. Sind die Säulen von Rissen durchzogen, können sie der schweren Last des wunderschönen Daches nicht mehr standhalten und stürzen in sich zusammen. Die Säulen unseres Gesundheits-Tempels stellen in diesem Fall die „Ernährung“, „Bewegung“, „Schlaf“, „Entspannung“ und „soziale Kontakte“ dar. Diese fünf Säulen halten uns gesund und bilden die standhaften und massiven Pfeiler unseres Gesundheits-Tempels. Säule 1: Ernährung Der westliche Ernährungsstil reich an ballaststoff- und nährstoffarmen, zeitgleich energiedichten Lebensmitteln und Getränken fördert nachweislich die Entwicklung von Zivilisationserkrankungen wie beispielsweise Übergewicht und Diabetes mellitus Typ 2. Achte darauf so bunt wie möglich zu essen, das bedeutet ausreichend Gemüse, Salate, Obst, aber auch hochwertige Eiweiß- Fett- und je nach Aktivität Kohlenhydratquellen in deinen Mahlzeiten zu integrieren. Säule 2: Bewegung Sowohl eine ausreichende Alltagsbewegung als auch die regelmäßige Durchführung von kräftigenden Übungen und von Ausdauertraining wirken sich positiv unter anderem auf dein Herz-Kreislauf-System, deine Knochengesundheit, deine Muskelkraft und Muskelmasse aus. Um nicht „einzurosten“, solltest du deinen Körper regelmäßig auf unterschiedliche Art und Weise bewegen und belasten. Säule 3: Schlaf Schlaf ist keine „tote Zeit“. Während des Schlafs laufen gewisse körperliche Prozesse auf Hochtouren. Es werden unter anderem Wachstumsfaktoren ausgeschüttet, das Erlebte aus dem Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis überführt, Stoffwechselabbauprodukte aus dem Hirnwasser „ausgeschwemmt“ und die Regeneration des Körpers angestoßen. Wird über mehrere Jahre hinweg zu wenig bzw. schlecht geschlafen, könnte laut ersten Hinweisen langfristig das Risiko für die Entwicklung von neurodegenerativen Erkrankungen (z.B. Alzheimer) steigen. Säule 4: Entspannung Chronischer Stress macht krank. Da Stress nicht komplett aus dem Leben isoliert werden kann, ist es von großer Bedeutung, dass in Phasen der Anspannung immer auch aktiv Phasen der Entspannung integriert werden. Den Zustand der Entspannung kannst du beispielsweise durch Entspannungstechniken wie Atemübungen, autogenes Training, Qigong oder Meditationen erreichen. Säule 5: Soziale Kontakte Soziale Kontakte sind hinsichtlich der mentalen Gesundheit von sehr großer Bedeutung. Der Mensch ist kein Einzelgänger. Studien zeigen, dass Einsamkeit unter anderem das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigern kann. Pflege den Kontakt zu deinen Liebsten, auch wenn es in gewissen Lebensphasen herausfordernd sein kann. Prävention statt Schadensbekämpfung Lege deinen Fokus nicht nur auf eine Säule, sondern versuche nach und nach, jedem der fünf Säulen deine Aufmerksamkeit zu schenken, um sie zu „restaurieren“ und somit zu stärken. Es wird dir mit großer Wahrscheinlichkeit nicht möglich sein, deinen Fokus zu jeder Zeit auf allen fünf Säulen zu legen – und das ist auch nicht notwendig. Wichtig ist nur, dass du langfristig gesehen keine der fünf Säulen „vergisst“. Jede einzelne Säule nimmt eine entscheidende Rolle in deiner Gesundheit ein, doch nur gemeinsam sind sie in der Lage deinen „Gesundheits-Tempel“ zu stabilisieren und das prachtvolle Dach zu tragen. Quelle: Leigh-Hunt N, Bagguley D, Bash K, Turner V, Turnbull S, Valtorta N, Caan W (2017): An overview of systematic reviews on the public health consequences of social isolation and loneliness. Public Health, 151:157-171 Musiek ES, Holtzmann DM (2016): Mechanisms linking circadian clocks, sleep, and neurodegeneration. Science, 354(6315):1004-1008 Rakhra V, Galappaththy SL, Bulchandani S, Cabandugama PK (2020): Obesity and the Western Diet: How We Got Here. Mo Med, 117(6):536-538 Hallal PC, Victora CG, Azevedo MR, Wells JC (2006): Adolescent physical activity and health: a systematic review. Sports Med, 36(12):1019-30 Knezevic E, Nenic K, Milanovic V, Knezevic NN (2023): The Role of Cortisol in Chronic Stress, Neurodegenerative Diseases, and Psychological Disorders. Cells, 12(23):2726
Die fünf Säulen der Gesundheit
Deine Gesundheit ist dein Tempel Stelle dir deine Gesundheit wie einen Tempel vor, dessen prachtvolles Dach durch fünf Säulen getragen wird. Diese fünf Säulen sind zwar aus robusten Steinen erbaut, erlangen über die Jahre hinweg (durch beispielsweise Umweltfaktoren) jedoch kleine Risse, die sich, wenn sie nicht restauriert werden, zu immer größeren Rissen entwickeln. Sind die Säulen von Rissen durchzogen, können sie der schweren Last des wunderschönen Daches nicht mehr standhalten und stürzen in sich zusammen. Die Säulen unseres Gesundheits-Tempels stellen in diesem Fall die „Ernährung“, „Bewegung“, „Schlaf“, „Entspannung“ und „soziale Kontakte“ dar. Diese fünf Säulen halten uns gesund und bilden die standhaften und massiven Pfeiler unseres Gesundheits-Tempels. Säule 1: Ernährung Der westliche Ernährungsstil reich an ballaststoff- und nährstoffarmen, zeitgleich energiedichten Lebensmitteln und Getränken fördert nachweislich die Entwicklung von Zivilisationserkrankungen wie beispielsweise Übergewicht und Diabetes mellitus Typ 2. Achte darauf so bunt wie möglich zu essen, das bedeutet ausreichend Gemüse, Salate, Obst, aber auch hochwertige Eiweiß- Fett- und je nach Aktivität Kohlenhydratquellen in deinen Mahlzeiten zu integrieren. Säule 2: Bewegung Sowohl eine ausreichende Alltagsbewegung als auch die regelmäßige Durchführung von kräftigenden Übungen und von Ausdauertraining wirken sich positiv unter anderem auf dein Herz-Kreislauf-System, deine Knochengesundheit, deine Muskelkraft und Muskelmasse aus. Um nicht „einzurosten“, solltest du deinen Körper regelmäßig auf unterschiedliche Art und Weise bewegen und belasten. Säule 3: Schlaf Schlaf ist keine „tote Zeit“. Während des Schlafs laufen gewisse körperliche Prozesse auf Hochtouren. Es werden unter anderem Wachstumsfaktoren ausgeschüttet, das Erlebte aus dem Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis überführt, Stoffwechselabbauprodukte aus dem Hirnwasser „ausgeschwemmt“ und die Regeneration des Körpers angestoßen. Wird über mehrere Jahre hinweg zu wenig bzw. schlecht geschlafen, könnte laut ersten Hinweisen langfristig das Risiko für die Entwicklung von neurodegenerativen Erkrankungen (z.B. Alzheimer) steigen. Säule 4: Entspannung Chronischer Stress macht krank. Da Stress nicht komplett aus dem Leben isoliert werden kann, ist es von großer Bedeutung, dass in Phasen der Anspannung immer auch aktiv Phasen der Entspannung integriert werden. Den Zustand der Entspannung kannst du beispielsweise durch Entspannungstechniken wie Atemübungen, autogenes Training, Qigong oder Meditationen erreichen. Säule 5: Soziale Kontakte Soziale Kontakte sind hinsichtlich der mentalen Gesundheit von sehr großer Bedeutung. Der Mensch ist kein Einzelgänger. Studien zeigen, dass Einsamkeit unter anderem das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigern kann. Pflege den Kontakt zu deinen Liebsten, auch wenn es in gewissen Lebensphasen herausfordernd sein kann. Prävention statt Schadensbekämpfung Lege deinen Fokus nicht nur auf eine Säule, sondern versuche nach und nach, jedem der fünf Säulen deine Aufmerksamkeit zu schenken, um sie zu „restaurieren“ und somit zu stärken. Es wird dir mit großer Wahrscheinlichkeit nicht möglich sein, deinen Fokus zu jeder Zeit auf allen fünf Säulen zu legen – und das ist auch nicht notwendig. Wichtig ist nur, dass du langfristig gesehen keine der fünf Säulen „vergisst“. Jede einzelne Säule nimmt eine entscheidende Rolle in deiner Gesundheit ein, doch nur gemeinsam sind sie in der Lage deinen „Gesundheits-Tempel“ zu stabilisieren und das prachtvolle Dach zu tragen. Quelle: Leigh-Hunt N, Bagguley D, Bash K, Turner V, Turnbull S, Valtorta N, Caan W (2017): An overview of systematic reviews on the public health consequences of social isolation and loneliness. Public Health, 151:157-171 Musiek ES, Holtzmann DM (2016): Mechanisms linking circadian clocks, sleep, and neurodegeneration. Science, 354(6315):1004-1008 Rakhra V, Galappaththy SL, Bulchandani S, Cabandugama PK (2020): Obesity and the Western Diet: How We Got Here. Mo Med, 117(6):536-538 Hallal PC, Victora CG, Azevedo MR, Wells JC (2006): Adolescent physical activity and health: a systematic review. Sports Med, 36(12):1019-30 Knezevic E, Nenic K, Milanovic V, Knezevic NN (2023): The Role of Cortisol in Chronic Stress, Neurodegenerative Diseases, and Psychological Disorders. Cells, 12(23):2726

Melatonin – mehr als nur ein Schlafhormon?
Melatonin ist den meisten wohl als das „Schlafhormon“ schlechthin bekannt. Immer mehr Studien zeigen jedoch, dass Melatonin nicht nur für einen erholsamen Schlaf entscheidend ist, sondern sich auch anderweitig positiv auf die Gesundheit auswirken kann. Im Folgenden werden einige Wirkweisen von Melatonin näher dargestellt. Schlaf-Wach-Rhythmus Melatonin wird hauptsächlich von der Zirbeldrüse im Gehirn produziert. Es steuert den Schlaf-Wach-Rhythmus und ist dafür verantwortlich, dass wir müde werden. Der Zyklus von Licht und Dunkelheit beeinflusst hierbei die Freisetzung von Melatonin. Während helles, blaues Licht die Melatoninproduktion hemmt, fördert Dunkelheit dessen Ausschüttung. Die Melatonin-Konzentration erreicht zwischen 2 und 4 Uhr morgens ihren Höhepunkt. Antioxidans Melatonin ist nicht nur für den Schlaf-Wach-Rhythmus entscheidend, sondern scheint darüber hinaus ein starkes Antioxidans mit Entzündung regulierender Wirkung zu sein. Hierdurch kann es Zellschädigungen, die von sogenannten freien Radikalen verursacht werden, verhindern. Melatoninproduktion in der Plazenta von Schwangeren Die Plazenta ist ein vielseitiges Organ, das nur temporär während einer Schwangerschaft im Körper einer Frau zu finden ist. Sie versorgt das Ungeborene mit Nährstoffen und Sauerstoff, transportiert unter anderem Abfallstoffe ab und produziert Hormone, welche die Schwangerschaft aufrechterhalten. Sie wächst während der gesamten Schwangerschaft, löst sich nach der Geburt von der Gebärmutter ab und wird als Nachgeburt ausgestoßen. Aktuelle Studien zeigen, dass Melatonin ein wichtiges Hormon während der Schwangerschaft (insbesondere in der Plazenta) darstellt. Die Melatonin-Konzentration im Blut ist bei Schwangeren höher als bei Nichtschwangeren. Zum Geburtstermin erreicht der Melatonin-Spiegel seinen Höhepunkt. Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Plazenta die Hauptquelle dieses Melatonins ist. Wie die Plazenta Melatonin produziert und ob der zirkadiane Rhythmus hierbei eine Rolle spielt, muss noch untersucht werden. Das Immunsystem der Mutter wird bei einer gesunden Schwangerschaft kontinuierlich an die Bedürfnisse des Ungeborenen angepasst. Melatonin scheint hierbei auf Grund seiner antioxidativen Eigenschaften eine nicht unerhebliche Rolle zu spielen und Schwangerschaftskomplikationen vorzubeugen. Störungen des zirkadianen Rhythmus während der Schwangerschaft scheinen die Entstehung chronischer Erkrankungen wie Diabetes mellitus, Adipositas und Herz-Kreislauferkrankungen des Kindes im späteren Leben zu fördern. Fazit Melatonin ist nicht nur für unsere Schlafqualität entscheidend, sondern scheint darüber hinaus ein starkes Antioxidans zu sein, das vor allem in der Schwangerschaft eine entscheidende Rolle in deren Aufrechterhaltung und der Gesundheit des Ungeborenen einnimmt. Um die genauen Wirkmechanismen zu verstehen, sollten weitere Untersuchungen durchgeführt werden. Quellen: Joseph TT, Schuch V, Hossack DJ, Chakraborty R, Johnson EL (2024): Melatonin: the placental antioxidant and anti-inflammatory. Front Immunol; 15:1339304 Cruz-Sanabria F, Carmassi C, Bruno S, Bazzani A, Carli M, Scarselli M, Faraguna U (2023): Melatonin as a Chronobiotic with Sleep-promoting Properties. Curr Neuropharmacol; 21(4):951-987
Melatonin – mehr als nur ein Schlafhormon?
Melatonin ist den meisten wohl als das „Schlafhormon“ schlechthin bekannt. Immer mehr Studien zeigen jedoch, dass Melatonin nicht nur für einen erholsamen Schlaf entscheidend ist, sondern sich auch anderweitig positiv auf die Gesundheit auswirken kann. Im Folgenden werden einige Wirkweisen von Melatonin näher dargestellt. Schlaf-Wach-Rhythmus Melatonin wird hauptsächlich von der Zirbeldrüse im Gehirn produziert. Es steuert den Schlaf-Wach-Rhythmus und ist dafür verantwortlich, dass wir müde werden. Der Zyklus von Licht und Dunkelheit beeinflusst hierbei die Freisetzung von Melatonin. Während helles, blaues Licht die Melatoninproduktion hemmt, fördert Dunkelheit dessen Ausschüttung. Die Melatonin-Konzentration erreicht zwischen 2 und 4 Uhr morgens ihren Höhepunkt. Antioxidans Melatonin ist nicht nur für den Schlaf-Wach-Rhythmus entscheidend, sondern scheint darüber hinaus ein starkes Antioxidans mit Entzündung regulierender Wirkung zu sein. Hierdurch kann es Zellschädigungen, die von sogenannten freien Radikalen verursacht werden, verhindern. Melatoninproduktion in der Plazenta von Schwangeren Die Plazenta ist ein vielseitiges Organ, das nur temporär während einer Schwangerschaft im Körper einer Frau zu finden ist. Sie versorgt das Ungeborene mit Nährstoffen und Sauerstoff, transportiert unter anderem Abfallstoffe ab und produziert Hormone, welche die Schwangerschaft aufrechterhalten. Sie wächst während der gesamten Schwangerschaft, löst sich nach der Geburt von der Gebärmutter ab und wird als Nachgeburt ausgestoßen. Aktuelle Studien zeigen, dass Melatonin ein wichtiges Hormon während der Schwangerschaft (insbesondere in der Plazenta) darstellt. Die Melatonin-Konzentration im Blut ist bei Schwangeren höher als bei Nichtschwangeren. Zum Geburtstermin erreicht der Melatonin-Spiegel seinen Höhepunkt. Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Plazenta die Hauptquelle dieses Melatonins ist. Wie die Plazenta Melatonin produziert und ob der zirkadiane Rhythmus hierbei eine Rolle spielt, muss noch untersucht werden. Das Immunsystem der Mutter wird bei einer gesunden Schwangerschaft kontinuierlich an die Bedürfnisse des Ungeborenen angepasst. Melatonin scheint hierbei auf Grund seiner antioxidativen Eigenschaften eine nicht unerhebliche Rolle zu spielen und Schwangerschaftskomplikationen vorzubeugen. Störungen des zirkadianen Rhythmus während der Schwangerschaft scheinen die Entstehung chronischer Erkrankungen wie Diabetes mellitus, Adipositas und Herz-Kreislauferkrankungen des Kindes im späteren Leben zu fördern. Fazit Melatonin ist nicht nur für unsere Schlafqualität entscheidend, sondern scheint darüber hinaus ein starkes Antioxidans zu sein, das vor allem in der Schwangerschaft eine entscheidende Rolle in deren Aufrechterhaltung und der Gesundheit des Ungeborenen einnimmt. Um die genauen Wirkmechanismen zu verstehen, sollten weitere Untersuchungen durchgeführt werden. Quellen: Joseph TT, Schuch V, Hossack DJ, Chakraborty R, Johnson EL (2024): Melatonin: the placental antioxidant and anti-inflammatory. Front Immunol; 15:1339304 Cruz-Sanabria F, Carmassi C, Bruno S, Bazzani A, Carli M, Scarselli M, Faraguna U (2023): Melatonin as a Chronobiotic with Sleep-promoting Properties. Curr Neuropharmacol; 21(4):951-987

Vitamin D und dessen Einfluss auf Depressionen
Was wird unter einer Depression verstanden? Eine Depression ist eine psychische Störung, die zu Stimmungs- und Angststörungen führt. Sie ist zu einer der weltweit häufigsten Krankheitsursachen geworden. Typisch empfundene Gefühle können Traurigkeit, Ängstlichkeit, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Gereiztheit oder Wertlosigkeit sein. Zudem können Depressionen zur Appetitlosigkeit, zu einem übermäßigem Essen, zur Bewegungsunfähigkeit und sogar zum Suizid führen. Wie viele Menschen leiden unter einer Depression? Laut der Weltgesundheitsorganisation sind weltweit mehr als 264 Millionen Menschen von Depressionen betroffen. Studien konnten zeigen, dass es vor allem während der COVID-19 Pandemie zu einem starken Anstieg von Depressionen kam. Vitamin D-Spiegel beeinflusst Depressionssymptome und - Risiko? Mehrere Studien, die eine Vielzahl von Studien in ihrer Bewertung einschlossen, kamen zu dem Ergebnis, dass eine Vitamin D-Ergänzung zur deutlichen Verringerung von Depressionssymptomen der Teilnehmenden führte. Zudem konnte nachgewiesen werden, dass Teilnehmer mit niedrigen Vitamin D-Spiegeln im Blut ein erhöhtes Risiko aufwiesen, an Depressionen zu erkranken, als jene mit höheren Vitamin D-Spiegeln. Vitamin D und Wochenbettdepression In etwa 10-30 % der Frauen entwickeln nach der Entbindung eine sogenannten postpartale Depression (Wochenbettdepression). Die genauen Ursachen hierfür sind noch nicht vollständig erforscht. So gibt es mehrere Theorien über das Zusammenspiel von Hormonen, Neurotransmittern, Genetik, Epigenetik und Nährstoffen. Studien deuten darauf hin, dass ein Vitamin D-Mangel mit dem Auftreten einer Wochenbettdepression in Zusammenhang steht und Vitamin D eine entscheidende Rolle bei der Genesung von Frauen mit postpartaler Depression spielen kann. *Disclaimer: Bei Verdacht auf Depressionen solltest du in jedem Falle einen Arzt aufsuchen. Quellen: Musazadeh V, Keramati M, Ghalichi F, Kavyani Z, Ghoreishi Z, Alras KA, Albadawi N, Salem A, Albadawi MI, Salem R, Abu-Zaid A, Zarezadeh M, Mekary RA (2023): Vitamin D protects against depression: Evidence from an umbrella meta-analysis on interventional and observational meta-analyses. Pharmacol Res, 187:106605 Amini S, Jafarirad S, Amani R (2019): Postpartum depression and vitamin D: A systematic review. Crit Rev Food Sci Nutr, 59(9):1514-1520 Rupanagunta GP, Nandave M, Rawat D, Upadhyay J, Rashid S, Ansari MN (2023): Postpartum depression: aetiology, pathogenesis and the role of nutrients and dietary supplements in prevention and management. Saudi Pharm J, 31(7):1274-1293
Vitamin D und dessen Einfluss auf Depressionen
Was wird unter einer Depression verstanden? Eine Depression ist eine psychische Störung, die zu Stimmungs- und Angststörungen führt. Sie ist zu einer der weltweit häufigsten Krankheitsursachen geworden. Typisch empfundene Gefühle können Traurigkeit, Ängstlichkeit, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Gereiztheit oder Wertlosigkeit sein. Zudem können Depressionen zur Appetitlosigkeit, zu einem übermäßigem Essen, zur Bewegungsunfähigkeit und sogar zum Suizid führen. Wie viele Menschen leiden unter einer Depression? Laut der Weltgesundheitsorganisation sind weltweit mehr als 264 Millionen Menschen von Depressionen betroffen. Studien konnten zeigen, dass es vor allem während der COVID-19 Pandemie zu einem starken Anstieg von Depressionen kam. Vitamin D-Spiegel beeinflusst Depressionssymptome und - Risiko? Mehrere Studien, die eine Vielzahl von Studien in ihrer Bewertung einschlossen, kamen zu dem Ergebnis, dass eine Vitamin D-Ergänzung zur deutlichen Verringerung von Depressionssymptomen der Teilnehmenden führte. Zudem konnte nachgewiesen werden, dass Teilnehmer mit niedrigen Vitamin D-Spiegeln im Blut ein erhöhtes Risiko aufwiesen, an Depressionen zu erkranken, als jene mit höheren Vitamin D-Spiegeln. Vitamin D und Wochenbettdepression In etwa 10-30 % der Frauen entwickeln nach der Entbindung eine sogenannten postpartale Depression (Wochenbettdepression). Die genauen Ursachen hierfür sind noch nicht vollständig erforscht. So gibt es mehrere Theorien über das Zusammenspiel von Hormonen, Neurotransmittern, Genetik, Epigenetik und Nährstoffen. Studien deuten darauf hin, dass ein Vitamin D-Mangel mit dem Auftreten einer Wochenbettdepression in Zusammenhang steht und Vitamin D eine entscheidende Rolle bei der Genesung von Frauen mit postpartaler Depression spielen kann. *Disclaimer: Bei Verdacht auf Depressionen solltest du in jedem Falle einen Arzt aufsuchen. Quellen: Musazadeh V, Keramati M, Ghalichi F, Kavyani Z, Ghoreishi Z, Alras KA, Albadawi N, Salem A, Albadawi MI, Salem R, Abu-Zaid A, Zarezadeh M, Mekary RA (2023): Vitamin D protects against depression: Evidence from an umbrella meta-analysis on interventional and observational meta-analyses. Pharmacol Res, 187:106605 Amini S, Jafarirad S, Amani R (2019): Postpartum depression and vitamin D: A systematic review. Crit Rev Food Sci Nutr, 59(9):1514-1520 Rupanagunta GP, Nandave M, Rawat D, Upadhyay J, Rashid S, Ansari MN (2023): Postpartum depression: aetiology, pathogenesis and the role of nutrients and dietary supplements in prevention and management. Saudi Pharm J, 31(7):1274-1293

Blutfettwerte leicht erklärt
Da erhöhte Blutfettwerte das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen steigern können, sollten sie im Optimalfall regelmäßig kontrolliert werden, um frühzeitig intervenieren zu können. Welche Werte zur Risikoeinschätzung bestimmt werden können und was die einzelnen Werte aussagen, wird im Folgenden näher beleuchtet. Triglyzeride Triglyzeride stellen die häufigste Form von Fett im Blut dar. Ihre Anzahl steigt unter anderem, sobald Nahrung aufgenommen wird. Sie können im Fettgewebe gespeichert werden und dienen als Energiereserve. Ein hoher Triglyzerid-Wert kann das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen erhöhen. Hohe Nüchternwerte werden unter anderem mit einer Insulinresistenz in Verbindung gebracht. Gesamtcholesterin Das Gesamtcholesterin umfasst die Summe aller „Cholesterin-Formen“ im Blut. Der Gesamtwert allein gibt somit keine detaillierten Informationen über das Verhältnis verschiedener „Cholesterin-Formen“. Hinsichtlich der Einschätzung des Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist es entscheidend, die einzelnen Cholesterin-Formen zu bestimmen und näher zu betrachten. HDL-Cholesterin Der HDL-Transporter („high-density lipoprotein“) transportiert überschüssiges Cholesterin aus den Blutgefäßen zur Leber, wo es abgebaut werden kann. Hohe HDL-Cholesterinwerte sind mit einem verringerten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden. LDL-Cholesterin Der LDL-Transporter („low-density lipoprotein“) transportiert Cholesterin von der Leber durch den gesamten Körper. Ein hoher LDL-Cholesterin-Wert wird häufig mit Arteriosklerose (Ablagerungen in den Blutgefäßen) in Verbindung gebracht und somit als Risikofaktor für Herzinfarkt und Schlaganfall betrachtet, weshalb ein niedriger LDL-Cholesterin-Wert als gesundheitsförderlich angesehen wird. Apo B Die Apolipoprotein B (apoB)-Konzentration weist auf die Gesamtanzahl von LDL-Partikeln hin, die potentiell Ablagerungen in den Gefäßen verursachen können. Laut aktueller Studienlage kann die apoB-Konzentration im Blut das Risiko für Atherosklerose und somit für Herzinfarkte besser voraussagen als das LDL-Cholesterin. Lipoprotein(a) Lipoprotein(a) stellt einen weitgehend genetisch bestimmten Risikofaktor dar. Ein erhöhter Wert wird mit einem erhöhten Risiko für Atherosklerose und somit Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht. Quellen: Marston NA, Giugliano RP, Melloni GEM, Park JG, Morrill V, Blazing MA, Ference B, Stein E, Stroes ES, Braunwald E, Ellinor PT, Lubitz SA, Ruff CT, Sabatine MS (2022): Association of Apolipoprotein B-Containing Lipoproteins and Risk of Myocardial Infarction in Individuals With and Without Atherosclerosis: Distinguishing Between Particle Concentration, Type, and Content. JAMA Cardiol, 7(3):250-256 Lampsas S, Xenou M, Oikonomou E, Pantelidis P, Lysandrou A, Sarantos S, Goliopoulou A, Kalogeras K, Tsigkou V, Kalpis A, Paschou SA, Theofilis P, Vavuranakis M, Tousoulis D, Siasos G (2023): Lipoprotein(a) in Atherosclerotic Diseases: From Pathophysiology to Diagnosis and Treatment. Molecules, 28(3):969 Ference BA, Graham I, Tokgozoglu L, Catapano AL (2018): Impact of Lipids on Cardiovascular Health: JACC Health Promotion Series. J Am Coll Cardiol, 72(10):1141-1156
Blutfettwerte leicht erklärt
Da erhöhte Blutfettwerte das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen steigern können, sollten sie im Optimalfall regelmäßig kontrolliert werden, um frühzeitig intervenieren zu können. Welche Werte zur Risikoeinschätzung bestimmt werden können und was die einzelnen Werte aussagen, wird im Folgenden näher beleuchtet. Triglyzeride Triglyzeride stellen die häufigste Form von Fett im Blut dar. Ihre Anzahl steigt unter anderem, sobald Nahrung aufgenommen wird. Sie können im Fettgewebe gespeichert werden und dienen als Energiereserve. Ein hoher Triglyzerid-Wert kann das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen erhöhen. Hohe Nüchternwerte werden unter anderem mit einer Insulinresistenz in Verbindung gebracht. Gesamtcholesterin Das Gesamtcholesterin umfasst die Summe aller „Cholesterin-Formen“ im Blut. Der Gesamtwert allein gibt somit keine detaillierten Informationen über das Verhältnis verschiedener „Cholesterin-Formen“. Hinsichtlich der Einschätzung des Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist es entscheidend, die einzelnen Cholesterin-Formen zu bestimmen und näher zu betrachten. HDL-Cholesterin Der HDL-Transporter („high-density lipoprotein“) transportiert überschüssiges Cholesterin aus den Blutgefäßen zur Leber, wo es abgebaut werden kann. Hohe HDL-Cholesterinwerte sind mit einem verringerten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden. LDL-Cholesterin Der LDL-Transporter („low-density lipoprotein“) transportiert Cholesterin von der Leber durch den gesamten Körper. Ein hoher LDL-Cholesterin-Wert wird häufig mit Arteriosklerose (Ablagerungen in den Blutgefäßen) in Verbindung gebracht und somit als Risikofaktor für Herzinfarkt und Schlaganfall betrachtet, weshalb ein niedriger LDL-Cholesterin-Wert als gesundheitsförderlich angesehen wird. Apo B Die Apolipoprotein B (apoB)-Konzentration weist auf die Gesamtanzahl von LDL-Partikeln hin, die potentiell Ablagerungen in den Gefäßen verursachen können. Laut aktueller Studienlage kann die apoB-Konzentration im Blut das Risiko für Atherosklerose und somit für Herzinfarkte besser voraussagen als das LDL-Cholesterin. Lipoprotein(a) Lipoprotein(a) stellt einen weitgehend genetisch bestimmten Risikofaktor dar. Ein erhöhter Wert wird mit einem erhöhten Risiko für Atherosklerose und somit Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht. Quellen: Marston NA, Giugliano RP, Melloni GEM, Park JG, Morrill V, Blazing MA, Ference B, Stein E, Stroes ES, Braunwald E, Ellinor PT, Lubitz SA, Ruff CT, Sabatine MS (2022): Association of Apolipoprotein B-Containing Lipoproteins and Risk of Myocardial Infarction in Individuals With and Without Atherosclerosis: Distinguishing Between Particle Concentration, Type, and Content. JAMA Cardiol, 7(3):250-256 Lampsas S, Xenou M, Oikonomou E, Pantelidis P, Lysandrou A, Sarantos S, Goliopoulou A, Kalogeras K, Tsigkou V, Kalpis A, Paschou SA, Theofilis P, Vavuranakis M, Tousoulis D, Siasos G (2023): Lipoprotein(a) in Atherosclerotic Diseases: From Pathophysiology to Diagnosis and Treatment. Molecules, 28(3):969 Ference BA, Graham I, Tokgozoglu L, Catapano AL (2018): Impact of Lipids on Cardiovascular Health: JACC Health Promotion Series. J Am Coll Cardiol, 72(10):1141-1156

Kleines und Großes Blutbild leicht erklärt
Vielleicht kennst du das: Du gehst zum Hausarzt und lässt ein „großes Blutbild“ bestimmen, um zu checken, ob alles in Ordnung ist. Doch wie aussagekräftig ist das klassische „große Blutbild“, welche Marker werden hierfür bestimmt und wie grenzt es sich vom „kleinen Blutbild ab“? Kleines Blutbild Das kleine Blutbild gehört zum Routinelabor. Es zeigt die Menge und das Verhältnis verschiedener Blutzellen wie beispielsweise Erythrozyten (rote Blutkörperchen), Leukozyten (weiße Blutkörperchen) und Thrombozyten (Blutplättchen: entscheidend für die Blutgerinnung) an. Durch Veränderungen gewisser Blutzellen auf Grund von Nährstoff Mängeln (z.B. Eisenmangel) können erste Hinweise hinsichtlich einer Anämie (Blutarmut) im kleinen Blutbild ersichtlich werden. Auch erste Aussagen über das Immunsystem können getroffen werden. Großes Blutbild Das „große Blutbild“ beinhaltet das „kleine Blutbild“ und das sogenannte „Differenzialblutbild“. Beim Differentialblutbild werden die Leukozyten differenziert betrachtet. Das bedeutet, dass die genaue Anzahl der verschiedenen weißen Blutkörperchen aufgelistet wird. Weiße Blutkörperchen werden unterteilt in „Neutrophile“, „Eosinophile“, „Basophile“, „Monozyten“ und „Lymphozyten“. Erhöhte oder erniedrigte Werte können (je nach Marker) beispielsweise auf Infektionen, Nährstoffmängel, Entzündungen, Allergien, Stress, Parasiten oder Autoimmunerkrankungen hinweisen. Wie aussagekräftig sind das kleine und das große Blutbild? Das kleine und das große Blutbild dienen als grober Überblick und können erste Hinweise auf den Gesundheitszustand geben. Veränderungen der Blutparameter sollten individuell weitere medizinische Testungen nach sich ziehen. Sowohl das kleine als auch das große Blutbild detektieren nicht spezifisch. Das bedeutet: Gewisse Nährstoffmängel oder eingeschränkte Organfunktionen können hiermit nicht abgebildet werden. Selbst wenn die gemessenen Blutwerte auf den ersten Blick im Normbereich liegen, kann der untersuchte Mensch unter einer Vielzahl an Beschwerden leiden und sich nicht gesund fühlen. Quelle: Wenzel T (2021): Was bedeutet eigentlich kleines und großes Blutbild? Klinikum Darmstadt.
Kleines und Großes Blutbild leicht erklärt
Vielleicht kennst du das: Du gehst zum Hausarzt und lässt ein „großes Blutbild“ bestimmen, um zu checken, ob alles in Ordnung ist. Doch wie aussagekräftig ist das klassische „große Blutbild“, welche Marker werden hierfür bestimmt und wie grenzt es sich vom „kleinen Blutbild ab“? Kleines Blutbild Das kleine Blutbild gehört zum Routinelabor. Es zeigt die Menge und das Verhältnis verschiedener Blutzellen wie beispielsweise Erythrozyten (rote Blutkörperchen), Leukozyten (weiße Blutkörperchen) und Thrombozyten (Blutplättchen: entscheidend für die Blutgerinnung) an. Durch Veränderungen gewisser Blutzellen auf Grund von Nährstoff Mängeln (z.B. Eisenmangel) können erste Hinweise hinsichtlich einer Anämie (Blutarmut) im kleinen Blutbild ersichtlich werden. Auch erste Aussagen über das Immunsystem können getroffen werden. Großes Blutbild Das „große Blutbild“ beinhaltet das „kleine Blutbild“ und das sogenannte „Differenzialblutbild“. Beim Differentialblutbild werden die Leukozyten differenziert betrachtet. Das bedeutet, dass die genaue Anzahl der verschiedenen weißen Blutkörperchen aufgelistet wird. Weiße Blutkörperchen werden unterteilt in „Neutrophile“, „Eosinophile“, „Basophile“, „Monozyten“ und „Lymphozyten“. Erhöhte oder erniedrigte Werte können (je nach Marker) beispielsweise auf Infektionen, Nährstoffmängel, Entzündungen, Allergien, Stress, Parasiten oder Autoimmunerkrankungen hinweisen. Wie aussagekräftig sind das kleine und das große Blutbild? Das kleine und das große Blutbild dienen als grober Überblick und können erste Hinweise auf den Gesundheitszustand geben. Veränderungen der Blutparameter sollten individuell weitere medizinische Testungen nach sich ziehen. Sowohl das kleine als auch das große Blutbild detektieren nicht spezifisch. Das bedeutet: Gewisse Nährstoffmängel oder eingeschränkte Organfunktionen können hiermit nicht abgebildet werden. Selbst wenn die gemessenen Blutwerte auf den ersten Blick im Normbereich liegen, kann der untersuchte Mensch unter einer Vielzahl an Beschwerden leiden und sich nicht gesund fühlen. Quelle: Wenzel T (2021): Was bedeutet eigentlich kleines und großes Blutbild? Klinikum Darmstadt.

Das meist unterschätzte Brainfood
Eine ausreichende Aufnahme von Wasser ist nicht nur entscheidend für den Glow auf deiner Haut. Wasser dient im Körper unter anderem als Lösungs- und Transportmittel und ist mengenmäßig die wichtigste Komponente des menschlichen Körpers. Das Gesamtkörperwasser kann zwischen 45 % und 70 % variieren und ist vom Körperfettanteil, vom Körpergewicht, vom Alter und vom Geschlecht abhängig. Eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme ist entscheidend für eine reibungslose Verdauung. Darüber hinaus benötigen wir Wasser, damit das Gehirn optimal arbeiten kann. Was wird unter dem Begriff „Brainfood“ verstanden? Zu den sogenannten „Brainfoods“ werden Lebensmittel gezählt, die das Gehirn mit Nährstoffen versorgen und hierdurch die Gehirnleistung bzw. Konzentrationsfähigkeit verbessern können. Beim Begriff Brainfood wird wohl am wenigsten an Wasser gedacht. Wasser stellt jedoch eines der wichtigsten Brainfoods überhaupt dar. Folgen einer akuten Dehydration Bereits beim Verlust von 2 % der Gesamte Körperflüssigkeit treten erste Einschränkungen der Leistungsfähigkeit auf. Das bedeutet, du kannst dich beispielsweise schlechter konzentrieren, leidest unter Kopfschmerzen, oder Müdigkeit. Bei einem Verlust von 3 % Gesamt Körperflüssigkeit kommt es zum Rückgang der Speichel- und Harn Sekretion, bei 5 % zur Steigerung der Herzfrequenz und zum Temperaturanstieg, bei 10 % zu Verwirrungszustände und bei 20 % zum Tod. Da es bereits beim Verlust von 2 % Gesamt Körperflüssigkeit zu Einbußen der Konzentrationsfähigkeit kommen kann, sollte, um die kognitive Leistungsfähigkeit zu unterstützen, stets auf einen ausreichenden Hydratationsstatus geachtet werden. Ein Verlust von 2 % des Gesamtkörperwassers entspricht je nach Gesamtkörperwasser etwa 0,9-1,2 Litern. Harnvolumen und -farbe als Marker des Hydratationsstatus Das Harnvolumen entspricht dem Trinkvolumen. Das bedeutet: Wird wenig Harn abgegeben, wurde zu wenig getrunken. Die Harnabgabe stellt somit einen guten Marker zur Bestimmung der Dehydration dar. Neben dem Harnvolumen kann zudem die Harnfarbe Aufschluss über den Hydratationsstatus geben. Je heller die Farbe des Urins, desto besser bist du mit Flüssigkeit versorgt. Im Umkehrschluss deutet dunkelgelber bis grünlicher Urin auf eine Dehydration hin. Wie viel Wasser sollte täglich getrunken werden? Je nach Aktivität und Schweißverlust wird empfohlen täglich zwischen 30-40 ml Flüssigkeit pro Kilogramm Körpergewicht zu trinken. Vorzugsweise in Form von Wasser oder ungesüßten Tee. Quellen: Köhnke K (2011): Der Wasserhaushalt und die ernährungsphysiologische Bedeutung von Wasser und Getränken. Ernährungs Umschau, 2/2011 Biesalski HK, Bischoff SC, Pirlich M, Weimann A (2018): Ernährungsmedizin – Nach dem Curriculum Ernährungsmedizin der Bundesärztekammer. 5. vollständig überarbeitete und erweiterte Ausgabe, Georg Thieme Verlag KG
Das meist unterschätzte Brainfood
Eine ausreichende Aufnahme von Wasser ist nicht nur entscheidend für den Glow auf deiner Haut. Wasser dient im Körper unter anderem als Lösungs- und Transportmittel und ist mengenmäßig die wichtigste Komponente des menschlichen Körpers. Das Gesamtkörperwasser kann zwischen 45 % und 70 % variieren und ist vom Körperfettanteil, vom Körpergewicht, vom Alter und vom Geschlecht abhängig. Eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme ist entscheidend für eine reibungslose Verdauung. Darüber hinaus benötigen wir Wasser, damit das Gehirn optimal arbeiten kann. Was wird unter dem Begriff „Brainfood“ verstanden? Zu den sogenannten „Brainfoods“ werden Lebensmittel gezählt, die das Gehirn mit Nährstoffen versorgen und hierdurch die Gehirnleistung bzw. Konzentrationsfähigkeit verbessern können. Beim Begriff Brainfood wird wohl am wenigsten an Wasser gedacht. Wasser stellt jedoch eines der wichtigsten Brainfoods überhaupt dar. Folgen einer akuten Dehydration Bereits beim Verlust von 2 % der Gesamte Körperflüssigkeit treten erste Einschränkungen der Leistungsfähigkeit auf. Das bedeutet, du kannst dich beispielsweise schlechter konzentrieren, leidest unter Kopfschmerzen, oder Müdigkeit. Bei einem Verlust von 3 % Gesamt Körperflüssigkeit kommt es zum Rückgang der Speichel- und Harn Sekretion, bei 5 % zur Steigerung der Herzfrequenz und zum Temperaturanstieg, bei 10 % zu Verwirrungszustände und bei 20 % zum Tod. Da es bereits beim Verlust von 2 % Gesamt Körperflüssigkeit zu Einbußen der Konzentrationsfähigkeit kommen kann, sollte, um die kognitive Leistungsfähigkeit zu unterstützen, stets auf einen ausreichenden Hydratationsstatus geachtet werden. Ein Verlust von 2 % des Gesamtkörperwassers entspricht je nach Gesamtkörperwasser etwa 0,9-1,2 Litern. Harnvolumen und -farbe als Marker des Hydratationsstatus Das Harnvolumen entspricht dem Trinkvolumen. Das bedeutet: Wird wenig Harn abgegeben, wurde zu wenig getrunken. Die Harnabgabe stellt somit einen guten Marker zur Bestimmung der Dehydration dar. Neben dem Harnvolumen kann zudem die Harnfarbe Aufschluss über den Hydratationsstatus geben. Je heller die Farbe des Urins, desto besser bist du mit Flüssigkeit versorgt. Im Umkehrschluss deutet dunkelgelber bis grünlicher Urin auf eine Dehydration hin. Wie viel Wasser sollte täglich getrunken werden? Je nach Aktivität und Schweißverlust wird empfohlen täglich zwischen 30-40 ml Flüssigkeit pro Kilogramm Körpergewicht zu trinken. Vorzugsweise in Form von Wasser oder ungesüßten Tee. Quellen: Köhnke K (2011): Der Wasserhaushalt und die ernährungsphysiologische Bedeutung von Wasser und Getränken. Ernährungs Umschau, 2/2011 Biesalski HK, Bischoff SC, Pirlich M, Weimann A (2018): Ernährungsmedizin – Nach dem Curriculum Ernährungsmedizin der Bundesärztekammer. 5. vollständig überarbeitete und erweiterte Ausgabe, Georg Thieme Verlag KG

Fit durch den Schulstart mit gesundem Pausenbrot
Ein Pausenbrot soll nicht nur sättigend und unkompliziert in der Handhabung sein, sondern darüber hinaus auch die Leistungsfähigkeit des Kindes in der Schule fördern. Viele Eltern stellen sich die Frage, welche Komponenten ein „gesundes“ Pausenbrot enthalten sollte. Ist eine belegte Laugenstange vom Bäcker gemeinsam mit einer Milchschnitte oder etwas Obst für zwischendurch ausreichend? Kraftpaket für Körper und Kopf Im Optimalfall enthält das Pausenbrot alle drei Makronährstoffe, das heißt: Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Kohlenhydrate Es sollten komplexe Kohlenhydrate bevorzugt werden, die langsam ins Blut aufgenommen werden und den Körper somit über einen längeren Zeitraum mit Energie versorgen können. Zu nennen sind hier beispielsweise Vollkornbrötchen und Vollkornbrot. Da nicht jedes Kind ein Fan von groben Vollkornprodukten ist, kann beim Kauf der Vollkornprodukte auf eine fein ausgemalte Variante geachtet werden. Wird dazu etwas Gemüse wie Gurken, Tomaten, Paprika oder Karotten gegeben, werden bereits ein bis zwei Gemüseportionen (empfohlen werden täglich mindestens vier Gemüseportionen) durch das Pausenbrot abgedeckt. In einem To-Go-Becher kann als Alternative zu Brot / Brötchen gerne ein Naturjoghurt mit frischem Obst, Haferflocken und wahlweise Honig eingepackt werden. Hierfür können To-Go-Becher erworben werden, die verschiedene „Abteilungen“ beinhalten, um beispielsweise die Haferflocken separat lagern zu können und erst kurz vor dem Verzehr dem Joghurt hinzuzufügen. Eiweiß Eiweiß ist nicht nur wichtig für den Muskelerhalt, -aufbau, das Immunsystem und das Hormonsystem, sondern auch für die Sättigung. Um dem Pausenbrot hochwertige Eiweißkomponenten beizufügen, können z.B. gekochte Eier, körniger Frischkäse / Frischkäse, Käse, Hummus oder Tofu integriert werden. Fette Fette sind nicht nur entscheidend für das Hormonsystem. Sie können sich zusätzlich positiv auf die Konzentrationsfähigkeit auswirken. Eine Hand voll Nüsse wie etwa Walnüsse oder Mandeln oder etwas Avocado auf dem Pausenbrot sorgen für eine gute Versorgung mit hochwertigen Fettsäuren. Anthocyane – Pflanzenpower für die kognitive Leistung Obstsorten wie beispielsweise Blaubeeren, Brombeeren sowie dunkle Johannisbeeren enthalten sekundäre Pflanzenstoffe, sogenannte Anthocyane. Sie geben dem Obst eine violette Farbe. In Studien konnte der Konsum eines Blaubeer Getränks (entsprach in etwa 240 g frischen Blaubeeren) die kognitive Leistungsfähigkeit von Kindern fördern. Dunkle Beeren stellen somit eine super Komponente in der Pausenversorgung dar. Trinken Egal wie gesund das Pausenbrot ist, für die Konzentrationsfähigkeit entscheidend ist vor allem eine ausreichende Hydration. Insbesondere Wasser, ungesüßter Tee oder aber eine stark verdünnte Saftschorlen (80 % Wasser, 20 % Saft) stellen gute Getränke zur Hydration dar. Zucker, gesüßte Getränke (z.B. Limonaden, Brausen, Nektare, Eistees, Energy Drinks, Softdrinks, …) sollten gemieden werden, da ein regelmäßiger Konsum von zucker gesüßten Getränken mit einem erhöhten Risiko für Übergewicht und Diabetes mellitus Typ 2 einhergeht. Quellen: Barfoot KL, May G, Lamport DJ, Ricketts J, Riddell PM, Williams CM (2019): The effects of acute wild blueberry supplementation on the cognition of 7-10-year-old schoolchildren. Eur J Nutr; 58(7):2911-2920 Biesalski HK, Bischoff SC, Pirlich M, Weimann A (2018): Ernährungsmedizin. Nach dem Curriculum Ernährungsmedizin der Bundesärztekammer. 5., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Georg Thieme Verlag KG
Fit durch den Schulstart mit gesundem Pausenbrot
Ein Pausenbrot soll nicht nur sättigend und unkompliziert in der Handhabung sein, sondern darüber hinaus auch die Leistungsfähigkeit des Kindes in der Schule fördern. Viele Eltern stellen sich die Frage, welche Komponenten ein „gesundes“ Pausenbrot enthalten sollte. Ist eine belegte Laugenstange vom Bäcker gemeinsam mit einer Milchschnitte oder etwas Obst für zwischendurch ausreichend? Kraftpaket für Körper und Kopf Im Optimalfall enthält das Pausenbrot alle drei Makronährstoffe, das heißt: Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Kohlenhydrate Es sollten komplexe Kohlenhydrate bevorzugt werden, die langsam ins Blut aufgenommen werden und den Körper somit über einen längeren Zeitraum mit Energie versorgen können. Zu nennen sind hier beispielsweise Vollkornbrötchen und Vollkornbrot. Da nicht jedes Kind ein Fan von groben Vollkornprodukten ist, kann beim Kauf der Vollkornprodukte auf eine fein ausgemalte Variante geachtet werden. Wird dazu etwas Gemüse wie Gurken, Tomaten, Paprika oder Karotten gegeben, werden bereits ein bis zwei Gemüseportionen (empfohlen werden täglich mindestens vier Gemüseportionen) durch das Pausenbrot abgedeckt. In einem To-Go-Becher kann als Alternative zu Brot / Brötchen gerne ein Naturjoghurt mit frischem Obst, Haferflocken und wahlweise Honig eingepackt werden. Hierfür können To-Go-Becher erworben werden, die verschiedene „Abteilungen“ beinhalten, um beispielsweise die Haferflocken separat lagern zu können und erst kurz vor dem Verzehr dem Joghurt hinzuzufügen. Eiweiß Eiweiß ist nicht nur wichtig für den Muskelerhalt, -aufbau, das Immunsystem und das Hormonsystem, sondern auch für die Sättigung. Um dem Pausenbrot hochwertige Eiweißkomponenten beizufügen, können z.B. gekochte Eier, körniger Frischkäse / Frischkäse, Käse, Hummus oder Tofu integriert werden. Fette Fette sind nicht nur entscheidend für das Hormonsystem. Sie können sich zusätzlich positiv auf die Konzentrationsfähigkeit auswirken. Eine Hand voll Nüsse wie etwa Walnüsse oder Mandeln oder etwas Avocado auf dem Pausenbrot sorgen für eine gute Versorgung mit hochwertigen Fettsäuren. Anthocyane – Pflanzenpower für die kognitive Leistung Obstsorten wie beispielsweise Blaubeeren, Brombeeren sowie dunkle Johannisbeeren enthalten sekundäre Pflanzenstoffe, sogenannte Anthocyane. Sie geben dem Obst eine violette Farbe. In Studien konnte der Konsum eines Blaubeer Getränks (entsprach in etwa 240 g frischen Blaubeeren) die kognitive Leistungsfähigkeit von Kindern fördern. Dunkle Beeren stellen somit eine super Komponente in der Pausenversorgung dar. Trinken Egal wie gesund das Pausenbrot ist, für die Konzentrationsfähigkeit entscheidend ist vor allem eine ausreichende Hydration. Insbesondere Wasser, ungesüßter Tee oder aber eine stark verdünnte Saftschorlen (80 % Wasser, 20 % Saft) stellen gute Getränke zur Hydration dar. Zucker, gesüßte Getränke (z.B. Limonaden, Brausen, Nektare, Eistees, Energy Drinks, Softdrinks, …) sollten gemieden werden, da ein regelmäßiger Konsum von zucker gesüßten Getränken mit einem erhöhten Risiko für Übergewicht und Diabetes mellitus Typ 2 einhergeht. Quellen: Barfoot KL, May G, Lamport DJ, Ricketts J, Riddell PM, Williams CM (2019): The effects of acute wild blueberry supplementation on the cognition of 7-10-year-old schoolchildren. Eur J Nutr; 58(7):2911-2920 Biesalski HK, Bischoff SC, Pirlich M, Weimann A (2018): Ernährungsmedizin. Nach dem Curriculum Ernährungsmedizin der Bundesärztekammer. 5., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Georg Thieme Verlag KG

Omega-3-Fettsäuren im Sport – worauf kommt es an?
Welche Fettsäuren zählen zu den Omega-3-Fettsäuren? Zu den Omega-3-Fettsäuren zählen sowohl die pflanzliche Omega-3-Fettsäure, die sogenannte „alpha-Linolensäure“ (ALA) sowie die marinen Omega-3-Fettsäuren „Eicosapentaensäure“ (EPA) und „Docosahexaensäure“ (DHA). ALA ist beispielsweise in Leinsamen, Walnüssen, Leinöl und Walnussöl zu finden. EPA und DHA sind dagegen vor allem in fettem Fisch wie Hering, Lachs und Makrelen enthalten. Haben pflanzliche und marine Omega-3-Fettsäuren die gleiche Wirkung? Pflanzliche und marine Omega-3-Fettsäuren entfalten nicht die gleiche Wirkung im Körper. Aus EPA und DHA kann unser Organismus (im Gegensatz zu ALA) hormonähnliche Stoffe bilden, die entzündungshemmend wirken können. Der menschliche Körper kann EPA und DHA zwar in gewissen Mengen aus der pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren alpha-Linolensäure herstellen - das Problem ist jedoch: Die Umwandlungsrate der mit der Nahrung aufgenommenen alpha-Linolensäure in EPA liegt bei lediglich 5-10 %, während die Umwandlung in DHA zwischen 2 und 5 % liegt. Manche Studien geben sogar an, dass weniger als 0,5 % in DHA umgewandelt werden können. Der Omega-3-Index kann durch die pflanzliche Omega-3-Fettsäure somit nicht erhöht werden. Was ist der Omega-3-Index und wie hoch sollte er sein? Der Omega-3-Index gibt an, wie viel EPA und DHA in der Hülle der roten Blutkörperchen vorhanden sind und somit wie gut die Zellen des Körpers mit marinen Omega-3-Fettsäuren versorgt sind. Er sollte beim Gesunden zwischen 8-11 % liegen. Die Deutschen weisen jedoch durchschnittlich einen Omega-3-Index von 4 bis 6 % auf und liegen somit unterhalb der Empfehlung. Omega-3-Fettsäuren im Sport Laut einer aktuellen Stellungnahme der „International Society of Sports Nutrition“ (ISSN) aus dem Jahr 2025 können Sportler ein erhöhtes Risiko eines Omega-3-Fettsäure-Mangels aufweisen. Eine Nahrungsergänzung von EPA und DHA konnte in Studien unter anderem die Ausdauerleistung verbessern. Zudem kann eine Ergänzung das Empfinden von Muskelkater nach intensivem Training verringern und sich positiv auf das Immunsystem von Sportlern auswirken. Sportler, die wiederholten Kopfstößen ausgesetzt sind (z.B. Kampfsportler), sollten vorsorglich Omega-3-Fettsäuren supplementieren, da sich die Einnahme von Omega-3-Fettsäuren schützend auf Nervenzellen auswirken kann. Darüber hinaus wird die Einnahme von EPA- und DHA-Supplementen mit einer verbesserten Schlafqualität in Verbindung gebracht, die hinsichtlich der Regeneration von Bedeutung ist. Darauf solltest du bei der Einnahme achten Eine Ernährung mit hohem Gehalt an EPA und DHA, einschließlich Nahrungsergänzungsmittel, stellt laut ISSN eine effektive Möglichkeit dar, den Omega-3-Index zu steigern. Da Omega-3-Fettsäuren fettlöslich sind, solltest du bei der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln darauf achten, diese zu einer fetthaltigen Mahlzeit einzunehmen. Quelle: Jäger R, Heileson JL, Abou Sawan S, Dickerson BL, Leonard M, Kreider RB, Kerksick CM, Cornish SM, Candow DG, Cordingley DM, Forbes SC, Tinsley GM, Bongiovanni T, Cannataro R, Campbell BI, Arent SM, Stout JR, Kalman DS, Antonio J (2025): International Society of Sports Nutrition Position Stand: Long-Chain Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids. J Int Soc Sports Nutr, 22(1):2441775
Omega-3-Fettsäuren im Sport – worauf kommt es an?
Welche Fettsäuren zählen zu den Omega-3-Fettsäuren? Zu den Omega-3-Fettsäuren zählen sowohl die pflanzliche Omega-3-Fettsäure, die sogenannte „alpha-Linolensäure“ (ALA) sowie die marinen Omega-3-Fettsäuren „Eicosapentaensäure“ (EPA) und „Docosahexaensäure“ (DHA). ALA ist beispielsweise in Leinsamen, Walnüssen, Leinöl und Walnussöl zu finden. EPA und DHA sind dagegen vor allem in fettem Fisch wie Hering, Lachs und Makrelen enthalten. Haben pflanzliche und marine Omega-3-Fettsäuren die gleiche Wirkung? Pflanzliche und marine Omega-3-Fettsäuren entfalten nicht die gleiche Wirkung im Körper. Aus EPA und DHA kann unser Organismus (im Gegensatz zu ALA) hormonähnliche Stoffe bilden, die entzündungshemmend wirken können. Der menschliche Körper kann EPA und DHA zwar in gewissen Mengen aus der pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren alpha-Linolensäure herstellen - das Problem ist jedoch: Die Umwandlungsrate der mit der Nahrung aufgenommenen alpha-Linolensäure in EPA liegt bei lediglich 5-10 %, während die Umwandlung in DHA zwischen 2 und 5 % liegt. Manche Studien geben sogar an, dass weniger als 0,5 % in DHA umgewandelt werden können. Der Omega-3-Index kann durch die pflanzliche Omega-3-Fettsäure somit nicht erhöht werden. Was ist der Omega-3-Index und wie hoch sollte er sein? Der Omega-3-Index gibt an, wie viel EPA und DHA in der Hülle der roten Blutkörperchen vorhanden sind und somit wie gut die Zellen des Körpers mit marinen Omega-3-Fettsäuren versorgt sind. Er sollte beim Gesunden zwischen 8-11 % liegen. Die Deutschen weisen jedoch durchschnittlich einen Omega-3-Index von 4 bis 6 % auf und liegen somit unterhalb der Empfehlung. Omega-3-Fettsäuren im Sport Laut einer aktuellen Stellungnahme der „International Society of Sports Nutrition“ (ISSN) aus dem Jahr 2025 können Sportler ein erhöhtes Risiko eines Omega-3-Fettsäure-Mangels aufweisen. Eine Nahrungsergänzung von EPA und DHA konnte in Studien unter anderem die Ausdauerleistung verbessern. Zudem kann eine Ergänzung das Empfinden von Muskelkater nach intensivem Training verringern und sich positiv auf das Immunsystem von Sportlern auswirken. Sportler, die wiederholten Kopfstößen ausgesetzt sind (z.B. Kampfsportler), sollten vorsorglich Omega-3-Fettsäuren supplementieren, da sich die Einnahme von Omega-3-Fettsäuren schützend auf Nervenzellen auswirken kann. Darüber hinaus wird die Einnahme von EPA- und DHA-Supplementen mit einer verbesserten Schlafqualität in Verbindung gebracht, die hinsichtlich der Regeneration von Bedeutung ist. Darauf solltest du bei der Einnahme achten Eine Ernährung mit hohem Gehalt an EPA und DHA, einschließlich Nahrungsergänzungsmittel, stellt laut ISSN eine effektive Möglichkeit dar, den Omega-3-Index zu steigern. Da Omega-3-Fettsäuren fettlöslich sind, solltest du bei der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln darauf achten, diese zu einer fetthaltigen Mahlzeit einzunehmen. Quelle: Jäger R, Heileson JL, Abou Sawan S, Dickerson BL, Leonard M, Kreider RB, Kerksick CM, Cornish SM, Candow DG, Cordingley DM, Forbes SC, Tinsley GM, Bongiovanni T, Cannataro R, Campbell BI, Arent SM, Stout JR, Kalman DS, Antonio J (2025): International Society of Sports Nutrition Position Stand: Long-Chain Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids. J Int Soc Sports Nutr, 22(1):2441775

Ketogene Ernährung – Die neue Trend-Diät?
Was wird unter einer ketogenen Ernährung verstanden? Bei einer ketogenen Ernährung wird die Energie zu einem hohen Anteil aus Fett und nicht aus Glucose (Kohlenhydraten) gewonnen. Einen ketogenen Ansatz verfolgen beispielsweise Ernährungsformen wie die Atkins-Diät, die Low-Carb-Diät oder die Paleo-Diät (Steinzeit-Diät). Durch eine ketogene Ernährung und damit die Aufnahme einer sehr fettreichen Kost entstehen im Körper sogenannte Ketonkörper, die zur Energieproduktion genutzt werden. Glucose wird hierbei als primäre Energiequelle abgelöst. Im Körper wird ein Fastenzustand („Ketose“) vorgetäuscht. Als Ernährungstherapie wird eine ketogene Diät laut Leitlinie bei schwer behandelbaren Epilepsien oder spezifischen Stoffwechselstörungen eingesetzt. Achtung bei der Proteinaufnahme Es gibt verschiedene Varianten der ketogenen Ernährung, die sich im Fettgehalt unterscheiden. In der Regel werden mindestens 60 % der aufgenommenen Energie in Form von Fett aufgenommen. Bei der klassischen ketogenen Diät werden 90 % der aufgenommenen Energie aus Fett aufgenommen. Bei der modifizierten Atkins-Diät wird in etwa 65 % der Energie aus Fett, 35 % aus Protein und nur 5 % aus Kohlenhydraten aufgenommen. Das Problem: Viele „ketogene Trenddiäten“, die beispielsweise auf den sozialen Medien dargestellt werden, enthalten eine zu große Menge an Protein. Warum ist eine zu hohe Aufnahme von Proteinen in dieser Hinsicht kontraproduktiv? Der Körper ist in der Lage, aus Aminosäuren selbstständig Glucose zu produzieren. Wird zu viel Protein über die Ernährung aufgenommen, kann es somit passieren, dass der eigentlich mit einer ketogenen Ernährung gewünschte Zustand der Ketose ausbleibt. Ketogene Ernährung im Sport?! Die bisherigen Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass eine ketogene Diät im Vergleich zu einer kohlenhydratreichen und fettarmen Ernährung weitgehend neutrale oder nachteilige Auswirkungen auf die sportliche Leistung hat. Laut der International Society of Sports Nutrition (ISSN) zeigen alle Studien an Spitzensportlern eine Leistungsminderung durch eine ketogene Ernährung. Bei Ausdauersportarten beeinträchtigt eine ketogene Diät die Fähigkeit des Körpers, Energie aus Glucose zu gewinnen, was bei hohen Intensitäten (sowohl im Training, als auch im Wettkampf) jedoch notwendig ist. Hinsichtlich des Krafttrainings scheinen kohlenhydratarme Diäten die Leistung nicht wesentlich zu beeinträchtigen. Einige Studien deuten jedoch darauf hin, dass kohlenhydratreiche Diäten für Kraftzuwächse und -erhalt besser geeignet sind. Ketogene Ernährung – eine mögliche Dauerernährung?! „Ausrutscher“ in der ketogenen Diät führen zur Reduktion der Ketonkörper im Blut. Die Diät muss daher streng eingehalten werden, was sich langfristig beim gesunden Menschen mehr nachteilig als vorteilhaft auf das Wohlbefinden auswirken kann. Bei einer nicht ausreichenden Aufnahme von Ballaststoffen können zudem Verstopfungen resultieren. Fazit Eine ketogene Ernährung kann vor allem aus ernährungs therapeutischer Sicht bei Indikationen wie schwer behandelbaren Epilepsien sehr sinnvoll sein. Da sie jedoch mit starken Einschränkungen unter anderem im Sozialleben einhergeht, wird sie nicht als langfristige Ernährungsform beim Gesunden empfohlen. Wer maximale Leistung im Sport abrufen und metabolisch flexibel bleiben möchte, sollte sich laut ISSN nicht ketogen ernähren. Übrigens: Während einer Schwangerschaft sollte eine ketogene Ernährung auf keinen Fall durchgeführt werden! Quellen: AWMF (2021): Ketogene Ernährungstherapien (KET) – Leitlinien der Gesellschaft für Neuropädiatrie. Nr. 022/021 McGaugh E, Barthel B (2022): A Review of Ketogenic Diet and Lifestyle. Mo Med, 119(1):84-88 Leaf A, Rothschild JA, Sharpe TM, Sims ST, Macias CJ, Futch GG, Roberts MD, Stout JR, Ormsbee MJ, Aragon AA, Campbell BI, Arent SM, D'Agostino DP, Barrack MT, Kerksick CM, Kreider RB, Kalman DS, Antonio J (2024): International society of sports nutrition position stand: ketogenic diets. J Int Soc Sports Nutr, 21(1):2368167
Ketogene Ernährung – Die neue Trend-Diät?
Was wird unter einer ketogenen Ernährung verstanden? Bei einer ketogenen Ernährung wird die Energie zu einem hohen Anteil aus Fett und nicht aus Glucose (Kohlenhydraten) gewonnen. Einen ketogenen Ansatz verfolgen beispielsweise Ernährungsformen wie die Atkins-Diät, die Low-Carb-Diät oder die Paleo-Diät (Steinzeit-Diät). Durch eine ketogene Ernährung und damit die Aufnahme einer sehr fettreichen Kost entstehen im Körper sogenannte Ketonkörper, die zur Energieproduktion genutzt werden. Glucose wird hierbei als primäre Energiequelle abgelöst. Im Körper wird ein Fastenzustand („Ketose“) vorgetäuscht. Als Ernährungstherapie wird eine ketogene Diät laut Leitlinie bei schwer behandelbaren Epilepsien oder spezifischen Stoffwechselstörungen eingesetzt. Achtung bei der Proteinaufnahme Es gibt verschiedene Varianten der ketogenen Ernährung, die sich im Fettgehalt unterscheiden. In der Regel werden mindestens 60 % der aufgenommenen Energie in Form von Fett aufgenommen. Bei der klassischen ketogenen Diät werden 90 % der aufgenommenen Energie aus Fett aufgenommen. Bei der modifizierten Atkins-Diät wird in etwa 65 % der Energie aus Fett, 35 % aus Protein und nur 5 % aus Kohlenhydraten aufgenommen. Das Problem: Viele „ketogene Trenddiäten“, die beispielsweise auf den sozialen Medien dargestellt werden, enthalten eine zu große Menge an Protein. Warum ist eine zu hohe Aufnahme von Proteinen in dieser Hinsicht kontraproduktiv? Der Körper ist in der Lage, aus Aminosäuren selbstständig Glucose zu produzieren. Wird zu viel Protein über die Ernährung aufgenommen, kann es somit passieren, dass der eigentlich mit einer ketogenen Ernährung gewünschte Zustand der Ketose ausbleibt. Ketogene Ernährung im Sport?! Die bisherigen Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass eine ketogene Diät im Vergleich zu einer kohlenhydratreichen und fettarmen Ernährung weitgehend neutrale oder nachteilige Auswirkungen auf die sportliche Leistung hat. Laut der International Society of Sports Nutrition (ISSN) zeigen alle Studien an Spitzensportlern eine Leistungsminderung durch eine ketogene Ernährung. Bei Ausdauersportarten beeinträchtigt eine ketogene Diät die Fähigkeit des Körpers, Energie aus Glucose zu gewinnen, was bei hohen Intensitäten (sowohl im Training, als auch im Wettkampf) jedoch notwendig ist. Hinsichtlich des Krafttrainings scheinen kohlenhydratarme Diäten die Leistung nicht wesentlich zu beeinträchtigen. Einige Studien deuten jedoch darauf hin, dass kohlenhydratreiche Diäten für Kraftzuwächse und -erhalt besser geeignet sind. Ketogene Ernährung – eine mögliche Dauerernährung?! „Ausrutscher“ in der ketogenen Diät führen zur Reduktion der Ketonkörper im Blut. Die Diät muss daher streng eingehalten werden, was sich langfristig beim gesunden Menschen mehr nachteilig als vorteilhaft auf das Wohlbefinden auswirken kann. Bei einer nicht ausreichenden Aufnahme von Ballaststoffen können zudem Verstopfungen resultieren. Fazit Eine ketogene Ernährung kann vor allem aus ernährungs therapeutischer Sicht bei Indikationen wie schwer behandelbaren Epilepsien sehr sinnvoll sein. Da sie jedoch mit starken Einschränkungen unter anderem im Sozialleben einhergeht, wird sie nicht als langfristige Ernährungsform beim Gesunden empfohlen. Wer maximale Leistung im Sport abrufen und metabolisch flexibel bleiben möchte, sollte sich laut ISSN nicht ketogen ernähren. Übrigens: Während einer Schwangerschaft sollte eine ketogene Ernährung auf keinen Fall durchgeführt werden! Quellen: AWMF (2021): Ketogene Ernährungstherapien (KET) – Leitlinien der Gesellschaft für Neuropädiatrie. Nr. 022/021 McGaugh E, Barthel B (2022): A Review of Ketogenic Diet and Lifestyle. Mo Med, 119(1):84-88 Leaf A, Rothschild JA, Sharpe TM, Sims ST, Macias CJ, Futch GG, Roberts MD, Stout JR, Ormsbee MJ, Aragon AA, Campbell BI, Arent SM, D'Agostino DP, Barrack MT, Kerksick CM, Kreider RB, Kalman DS, Antonio J (2024): International society of sports nutrition position stand: ketogenic diets. J Int Soc Sports Nutr, 21(1):2368167

Oxytocin – Das Kuschelhormon
Was ist Oxytocin? Oxytocin ist ein Hormon, das in den Medien häufig als „Kuschelhormon“ bezeichnet wird. Es nimmt neben der allgemeinen Gesundheit weitreichenden Einfluss auf die Entwicklung, Fortpflanzung, Wundheilung und das soziale Verhalten. Ausgeschüttet wird das Hormon unter anderem, wenn Nähe und Zuneigung zu anderen Menschen (durch z.B. Umarmungen oder Berührungen) oder auch zu Tieren (durch z.B. Streicheln) erlebt werden. Welche Aufgaben übernimmt das Hormon in unserem Körper? Oxytocin kann helfen, stressige Lebensphasen besser zu überstehen, indem es die Stressbewältigung unterstützt und zur Entspannung beiträgt. Es weist zudem antioxidative Wirkungen auf, beeinflusst das autonome Nervensystem (Nervensystem, das weitgehend nicht willentlich gesteuert werden kann) und das Immunsystem. Oxytocin wird in manchen wissenschaftlichen Artikeln als „natürliche Medizin“, die vor Stress und Krankheit schützt, beschrieben. Oxytocin während der Geburt und Stillzeit Oxytocin spielt eine wichtige Rolle während der Geburt, indem es Wehen initiiert und verstärkt und so zur Öffnung des Gebärmutterhalses beiträgt. Während der Stillzeit ist das Hormon für die Produktion der Muttermilch entscheidend. Durch das Saugen während des Stillens kommt es zur Oxytocin-Freisetzung im Gehirn der Mutter. Das Hormon stärkt die Bindung von Mutter und Kind und führt nach der Entbindung zur Kontraktion der Gebärmutter, wodurch deren Rückbildung gefördert wird. Oxytocin während der Menopause Die Menopause markiert das Ende der Fruchtbarkeit der Frau und geht häufig mit negativen Auswirkungen auf ihre körperliche und geistige Gesundheit einher. Mit Beginn der Wechseljahre nimmt der Oxytocinspiegel der Frau ab, während die Anfälligkeit für Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen, Osteoporose und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zunimmt. Da Oxytocin-Rezeptoren unter anderem im Gehirn, im Fortpflanzungs Gewebe, in Knochen und im Herzen zu finden sind, wird davon ausgegangen, dass Oxytocin eine wichtige Rolle bei der Funktion dieser Gewebe spielt und einen potentiellen Einfluss auf die Gesundheit und Stimmung von Frauen während der Menopause nimmt. Diesbezüglich sollten weitere Studien durchgeführt werden. Fazit Oxytocin ist weit mehr als ein „Kuschel-Hormon“. Es trägt nicht nur zur körperlichen und geistigen Gesundheit bei, sondern spielt darüber hinaus unter anderem eine entscheidende Rolle während der Geburt und Stillzeit. Bezüglich der Rolle von Oxytocin während der Menopause sollten weitere Studien durchgeführt werden. Quellen: Carter CS, Kenkel WM, MacLean EL, Wilson SR, Perkeybile AM, Yee JR, Ferris CF, Nazarloo HP, Porges SW, Davis JM, Connelly JJ, Kingsbury MA (2020): Is Oxytocin "Nature's Medicine"? Pharmacol Rev, 72(4):829-861 Krol KM, Grossmann T (2018): Psychological effects of breastfeeding on children and mothers. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz, 61(8):977-985 Dunietz GL, Tittle LJ, Mumford SL, O'Brien LM, Baylin A, Schisterman EF, Chervin RD, Young LJ (2024): Oxytocin and women's health in midlife. J Endocrinol, 262(1):e230396 Hermesch AC, Kernberg AS, Layoun VR, Caughey AB (2024): Oxytocin: physiology, pharmacology, and clinical application for labor management. Am J Obstet Gynecol, 230(3S):S729-S739
Oxytocin – Das Kuschelhormon
Was ist Oxytocin? Oxytocin ist ein Hormon, das in den Medien häufig als „Kuschelhormon“ bezeichnet wird. Es nimmt neben der allgemeinen Gesundheit weitreichenden Einfluss auf die Entwicklung, Fortpflanzung, Wundheilung und das soziale Verhalten. Ausgeschüttet wird das Hormon unter anderem, wenn Nähe und Zuneigung zu anderen Menschen (durch z.B. Umarmungen oder Berührungen) oder auch zu Tieren (durch z.B. Streicheln) erlebt werden. Welche Aufgaben übernimmt das Hormon in unserem Körper? Oxytocin kann helfen, stressige Lebensphasen besser zu überstehen, indem es die Stressbewältigung unterstützt und zur Entspannung beiträgt. Es weist zudem antioxidative Wirkungen auf, beeinflusst das autonome Nervensystem (Nervensystem, das weitgehend nicht willentlich gesteuert werden kann) und das Immunsystem. Oxytocin wird in manchen wissenschaftlichen Artikeln als „natürliche Medizin“, die vor Stress und Krankheit schützt, beschrieben. Oxytocin während der Geburt und Stillzeit Oxytocin spielt eine wichtige Rolle während der Geburt, indem es Wehen initiiert und verstärkt und so zur Öffnung des Gebärmutterhalses beiträgt. Während der Stillzeit ist das Hormon für die Produktion der Muttermilch entscheidend. Durch das Saugen während des Stillens kommt es zur Oxytocin-Freisetzung im Gehirn der Mutter. Das Hormon stärkt die Bindung von Mutter und Kind und führt nach der Entbindung zur Kontraktion der Gebärmutter, wodurch deren Rückbildung gefördert wird. Oxytocin während der Menopause Die Menopause markiert das Ende der Fruchtbarkeit der Frau und geht häufig mit negativen Auswirkungen auf ihre körperliche und geistige Gesundheit einher. Mit Beginn der Wechseljahre nimmt der Oxytocinspiegel der Frau ab, während die Anfälligkeit für Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen, Osteoporose und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zunimmt. Da Oxytocin-Rezeptoren unter anderem im Gehirn, im Fortpflanzungs Gewebe, in Knochen und im Herzen zu finden sind, wird davon ausgegangen, dass Oxytocin eine wichtige Rolle bei der Funktion dieser Gewebe spielt und einen potentiellen Einfluss auf die Gesundheit und Stimmung von Frauen während der Menopause nimmt. Diesbezüglich sollten weitere Studien durchgeführt werden. Fazit Oxytocin ist weit mehr als ein „Kuschel-Hormon“. Es trägt nicht nur zur körperlichen und geistigen Gesundheit bei, sondern spielt darüber hinaus unter anderem eine entscheidende Rolle während der Geburt und Stillzeit. Bezüglich der Rolle von Oxytocin während der Menopause sollten weitere Studien durchgeführt werden. Quellen: Carter CS, Kenkel WM, MacLean EL, Wilson SR, Perkeybile AM, Yee JR, Ferris CF, Nazarloo HP, Porges SW, Davis JM, Connelly JJ, Kingsbury MA (2020): Is Oxytocin "Nature's Medicine"? Pharmacol Rev, 72(4):829-861 Krol KM, Grossmann T (2018): Psychological effects of breastfeeding on children and mothers. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz, 61(8):977-985 Dunietz GL, Tittle LJ, Mumford SL, O'Brien LM, Baylin A, Schisterman EF, Chervin RD, Young LJ (2024): Oxytocin and women's health in midlife. J Endocrinol, 262(1):e230396 Hermesch AC, Kernberg AS, Layoun VR, Caughey AB (2024): Oxytocin: physiology, pharmacology, and clinical application for labor management. Am J Obstet Gynecol, 230(3S):S729-S739

Magnesiummangel im Sport
Magnesium spielt eine entscheidende Rolle für die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit bei Sportlern. Es zählt zu den essentiellen Mineralstoffen und muss somit zwingend über die Ernährung aufgenommen werden. Welche Aufgaben Magnesium im Körper übernimmt, was beachtet werden sollte, wenn regelmäßig Sport getrieben wird und wie die Magnesiumversorgung bestimmt werden kann, erfährst du im Folgenden. Einige Aufgaben von Magnesium Magnesium spielt unter anderem eine wichtige Rolle in der Immunabwehr, der Regeneration von oxidativem Stress, der Schmerzmodulation (Veränderungen in der Schmerzwahrnehmung), der Energieproduktion sowie der Proteinsynthese (Neubildung von körpereigenem Protein). Darüber hinaus steuert Magnesium die Umwandlung von Vitamin D in dessen aktive Form, die den Knochenstoffwechsel unterstützt. Im Umkehrschluss kann sich eine Magnesiumunterversorgung negativ auf den Knochenstoffwechsel auswirken. Magnesiumversorgung bei Sportlern Eine optimale Magnesiumversorgung ist bei Sportlern hinsichtlich der Leistungsfähigkeit von großer Bedeutung. Eine verminderte Magnesiumaufnahme wird mit einer niedrigeren Knochenmineraldichte in Verbindung gebracht, die als Risikofaktor für Stressfrakturen („Ermüdungsbrüche“) bei Sportlern zählt. Durch intensives Training oder Wettkämpfe, resultiert ein gesteigerter Magnesiumverlust über Schweiß und Urin. Werden diese Verluste nicht durch die Ernährung (oder mit Hilfe von magnesiumreichem Mineralwasser oder Supplementen) ausgeglichen, kann langfristig ein Magnesium-Defizit entstehen. In einer Studie an 70 Leistungssportlern konnte bei knapp 27 % ein Vollblut-Magnesium-Mangel nachgewiesen werden. Sportlerinnen waren hierbei deutlich schlechter versorgt als Sportler. Durch die tägliche Substitution von 370 mg Magnesium in Form von Nahrungsergänzungsmitteln verbesserte sich unter anderem der Magnesium Status, sowie die Mitochondrienfunktion deutlich. Mitochondrien stellen die „Kraftwerke der Zellen“ dar – hier wird Energie produziert, die für die Leistung im Sport essentiell ist. Wie wird die Magnesiumversorgung bestimmt? Nur ein sehr geringer Anteil des Magnesiums befindet sich frei im Blutserum. Aus diesem Grund sollte die Bestimmung des Magnesiums im Blutserum nicht zur Einschätzung der Magnesiumversorgung herangezogen werden. Aussagekräftiger ist es, Magnesium im Vollblut bestimmen zu lassen. Fazit Treibst du regelmäßig Sport, solltest du auf deine Magnesiumversorgung achten. Magnesiumreiche Lebensmittel sind beispielsweise Kerne und Samen (z.B. Mandeln, Kürbiskerne und Sesam), Vollkornprodukte oder Kakao. Magnesiumreiche Mineralwässer können ebenfalls zum Einsatz kommen. Falls es dir schwer fällt, deinen Magnesiumbedarf über die Ernährung zu decken, kannst du Magnesium in Form von Nahrungsergänzungsmitteln supplementieren. Quelle: Erpenbach K, Mayer W, Hoffmann U, Mücke S (2021): Zelluläre Magnesiumversorgung unter Magnesiumsubstitution im Leistungssport. In: OM & Ernährung 2021, Nr.176
Magnesiummangel im Sport
Magnesium spielt eine entscheidende Rolle für die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit bei Sportlern. Es zählt zu den essentiellen Mineralstoffen und muss somit zwingend über die Ernährung aufgenommen werden. Welche Aufgaben Magnesium im Körper übernimmt, was beachtet werden sollte, wenn regelmäßig Sport getrieben wird und wie die Magnesiumversorgung bestimmt werden kann, erfährst du im Folgenden. Einige Aufgaben von Magnesium Magnesium spielt unter anderem eine wichtige Rolle in der Immunabwehr, der Regeneration von oxidativem Stress, der Schmerzmodulation (Veränderungen in der Schmerzwahrnehmung), der Energieproduktion sowie der Proteinsynthese (Neubildung von körpereigenem Protein). Darüber hinaus steuert Magnesium die Umwandlung von Vitamin D in dessen aktive Form, die den Knochenstoffwechsel unterstützt. Im Umkehrschluss kann sich eine Magnesiumunterversorgung negativ auf den Knochenstoffwechsel auswirken. Magnesiumversorgung bei Sportlern Eine optimale Magnesiumversorgung ist bei Sportlern hinsichtlich der Leistungsfähigkeit von großer Bedeutung. Eine verminderte Magnesiumaufnahme wird mit einer niedrigeren Knochenmineraldichte in Verbindung gebracht, die als Risikofaktor für Stressfrakturen („Ermüdungsbrüche“) bei Sportlern zählt. Durch intensives Training oder Wettkämpfe, resultiert ein gesteigerter Magnesiumverlust über Schweiß und Urin. Werden diese Verluste nicht durch die Ernährung (oder mit Hilfe von magnesiumreichem Mineralwasser oder Supplementen) ausgeglichen, kann langfristig ein Magnesium-Defizit entstehen. In einer Studie an 70 Leistungssportlern konnte bei knapp 27 % ein Vollblut-Magnesium-Mangel nachgewiesen werden. Sportlerinnen waren hierbei deutlich schlechter versorgt als Sportler. Durch die tägliche Substitution von 370 mg Magnesium in Form von Nahrungsergänzungsmitteln verbesserte sich unter anderem der Magnesium Status, sowie die Mitochondrienfunktion deutlich. Mitochondrien stellen die „Kraftwerke der Zellen“ dar – hier wird Energie produziert, die für die Leistung im Sport essentiell ist. Wie wird die Magnesiumversorgung bestimmt? Nur ein sehr geringer Anteil des Magnesiums befindet sich frei im Blutserum. Aus diesem Grund sollte die Bestimmung des Magnesiums im Blutserum nicht zur Einschätzung der Magnesiumversorgung herangezogen werden. Aussagekräftiger ist es, Magnesium im Vollblut bestimmen zu lassen. Fazit Treibst du regelmäßig Sport, solltest du auf deine Magnesiumversorgung achten. Magnesiumreiche Lebensmittel sind beispielsweise Kerne und Samen (z.B. Mandeln, Kürbiskerne und Sesam), Vollkornprodukte oder Kakao. Magnesiumreiche Mineralwässer können ebenfalls zum Einsatz kommen. Falls es dir schwer fällt, deinen Magnesiumbedarf über die Ernährung zu decken, kannst du Magnesium in Form von Nahrungsergänzungsmitteln supplementieren. Quelle: Erpenbach K, Mayer W, Hoffmann U, Mücke S (2021): Zelluläre Magnesiumversorgung unter Magnesiumsubstitution im Leistungssport. In: OM & Ernährung 2021, Nr.176

Sollten gesunde Menschen Blutglucose-Sensoren tragen?
Auf den sozialen Medien wird es immer mehr zum „Trend“, dass gesunde Menschen Blutglucose-Sensoren tragen, um den Blutzuckerspiegel zu tracken und zu „optimieren“. Doch wie aussagekräftig sind die gemessenen Werte wirklich? Wie kann der Blutzuckerspiegel gemessen werden? Im Optimalfall wird die glykämische Reaktion (Blutzuckeranstieg) auf Lebensmittel mittels Blut aus der Fingerbeere gemessen. Um Diabetikern das Messen des Blutzuckerspiegels zu erleichtern und das ständige Piepen zu reduzieren, wurden Blutglucose-Sensoren entwickelt. Sie werden für mehrere Tage z.B. am Oberarm platziert und erleichtern hierdurch die Blutzuckerkontrolle. Was und für wen ist CGM CGM steht für „continuous glucose monitoring“ – „kontinuierliches Glucosemonitoring“. Die Sensoren messen rund um die Uhr den Glukosegehalt in der Gewebsflüssigkeit des Unterhautfettgewebes und übertragen die Werte auf ein Empfangsgerät wie das Smartphone. Die Sensoren schätzen durch die Messung des Glucosegehalts in der Gewebeflüssigkeit somit indirekt den Blutzuckerspiegel. Die Geräte sind für Menschen entwickelt, die an der Erkrankung Diabetes mellitus leiden. Wie aussagekräftig sind CGM-Sensoren beim Gesunden? Eine aktuelle (sehr kleine Studie) zeigt, dass der untersuchte CGM-Sensor (im Vergleich zur Messung des Blutzuckerspiegels im Blut) höhere Blutzuckerwerte sowohl im nüchternen Zustand als auch nach dem Konsum von Kohlenhydraten anzeigen. Die vom Sensor gemessenen Blutzuckerspitzen waren darüber hinaus länger erhöht, als es im Blut eigentlich der Fall war. Aufgrund der möglichen Überschätzung des Blutzuckerspiegels nach Messung mittels CGM geben die Autoren der Studie den Hinweis, dass Vorsicht für die Menschen geboten sei, die auf Grund dieser Daten Veränderungen in der Nahrungsmittelauswahl treffen möchten. Wer genaue Blutzuckerreaktionen auf kohlenhydratreiche Lebensmittel testen möchte, sollte den Blutzuckerspiegel mittels Blut aus der Fingerbeere messen. Blutzuckeranstiege bei Gesunden um jeden Preis vermeiden? Blutzuckeranstiege nach dem Verzehr von Nahrung sind physiologisch und somit ganz normal. Um die Insulinsensitivität zu fördern, sollte eine Achterbahnfahrt des Blutzuckerspiegels durch beispielsweise ständigem Snacken und dem übermäßigen Konsum von ballaststoffarmen Kohlenhydratquellen vermieden werden. Hierbei geht es jedoch keineswegs darum, Blutzuckeranstiege komplett zu meiden. Der menschliche Körper ist darauf ausgelegt, Blutzuckeranstiege zu regulieren. Es ist wichtig, diese metabolische Flexibilität zu erhalten. Kohlenhydrate sind nicht der Feind. Wichtig ist, die Menge der Kohlenhydrataufnahme der körperlichen Aktivität anzupassen. An Tagen, an denen du körperlich aktiv bist, darfst und solltest du eine größere Menge an Kohlenhydraten verzehren als an Tagen, an denen du körperlich inaktiv bist. Fazit Die glykämische Reaktion bzw. der Blutzuckeranstieg nach einer verzehrten Mahlzeit ist höchst individuell und variiert von Person zu Person teilweise stark. Es spielen Einflussfaktoren wie beispielsweise die Mahlzeiten, Zusammensetzung und -zubereitung, Bewegungsverhalten, Schlaf und die Tageszeit (zu der die Mahlzeit eingenommen wird) eine Rolle. Die ermittelten Werte eines CGM-Sensors sollten nicht auf die „Goldwaage“ gelegt werden. Für Menschen mit einer Insulinresistenz oder auch im Sport, könnten sie als grober Richtwert durchaus sinnvoll sein. Menschen, die beim Tragen eines Sensors übermäßig häufig die gemessenen Werte tracken und bei erhöhten Werten (die im Normbereich liegen) psychisch negativ beeinflusst werden, sollten CGM-Sensoren nicht nutzen. Quellen: Zeevi D, Korem T, Zmora N, Israeli D, Rothschild D, Weinberger A, Ben-Yacov O, Lador D, Avnit-Sagi T, Lotan-Pompan M, Suez J, Mahdi JA, Matot E, Malka G, Kosower N, Rein M, Zilberman-Schapira G, Dohnalová L, Pevsner-Fischer M, Bikovsky R, Halpern Z, Elinav E, Segal E (2015): Personalized Nutrition by Prediction of Glycemic Responses. Cell; 163(5):1079-1094 Hutchins KM, Betts JA, Thompson D, Hengist A, Gonzalez JT (2025): Continuous glucose monitor overestimates glycemia, with the magnitude of bias varying by postprandial test and individual - a randomized crossover trial. Am J Clin Nutr, S0002-9165(25)00092-9
Sollten gesunde Menschen Blutglucose-Sensoren tragen?
Auf den sozialen Medien wird es immer mehr zum „Trend“, dass gesunde Menschen Blutglucose-Sensoren tragen, um den Blutzuckerspiegel zu tracken und zu „optimieren“. Doch wie aussagekräftig sind die gemessenen Werte wirklich? Wie kann der Blutzuckerspiegel gemessen werden? Im Optimalfall wird die glykämische Reaktion (Blutzuckeranstieg) auf Lebensmittel mittels Blut aus der Fingerbeere gemessen. Um Diabetikern das Messen des Blutzuckerspiegels zu erleichtern und das ständige Piepen zu reduzieren, wurden Blutglucose-Sensoren entwickelt. Sie werden für mehrere Tage z.B. am Oberarm platziert und erleichtern hierdurch die Blutzuckerkontrolle. Was und für wen ist CGM CGM steht für „continuous glucose monitoring“ – „kontinuierliches Glucosemonitoring“. Die Sensoren messen rund um die Uhr den Glukosegehalt in der Gewebsflüssigkeit des Unterhautfettgewebes und übertragen die Werte auf ein Empfangsgerät wie das Smartphone. Die Sensoren schätzen durch die Messung des Glucosegehalts in der Gewebeflüssigkeit somit indirekt den Blutzuckerspiegel. Die Geräte sind für Menschen entwickelt, die an der Erkrankung Diabetes mellitus leiden. Wie aussagekräftig sind CGM-Sensoren beim Gesunden? Eine aktuelle (sehr kleine Studie) zeigt, dass der untersuchte CGM-Sensor (im Vergleich zur Messung des Blutzuckerspiegels im Blut) höhere Blutzuckerwerte sowohl im nüchternen Zustand als auch nach dem Konsum von Kohlenhydraten anzeigen. Die vom Sensor gemessenen Blutzuckerspitzen waren darüber hinaus länger erhöht, als es im Blut eigentlich der Fall war. Aufgrund der möglichen Überschätzung des Blutzuckerspiegels nach Messung mittels CGM geben die Autoren der Studie den Hinweis, dass Vorsicht für die Menschen geboten sei, die auf Grund dieser Daten Veränderungen in der Nahrungsmittelauswahl treffen möchten. Wer genaue Blutzuckerreaktionen auf kohlenhydratreiche Lebensmittel testen möchte, sollte den Blutzuckerspiegel mittels Blut aus der Fingerbeere messen. Blutzuckeranstiege bei Gesunden um jeden Preis vermeiden? Blutzuckeranstiege nach dem Verzehr von Nahrung sind physiologisch und somit ganz normal. Um die Insulinsensitivität zu fördern, sollte eine Achterbahnfahrt des Blutzuckerspiegels durch beispielsweise ständigem Snacken und dem übermäßigen Konsum von ballaststoffarmen Kohlenhydratquellen vermieden werden. Hierbei geht es jedoch keineswegs darum, Blutzuckeranstiege komplett zu meiden. Der menschliche Körper ist darauf ausgelegt, Blutzuckeranstiege zu regulieren. Es ist wichtig, diese metabolische Flexibilität zu erhalten. Kohlenhydrate sind nicht der Feind. Wichtig ist, die Menge der Kohlenhydrataufnahme der körperlichen Aktivität anzupassen. An Tagen, an denen du körperlich aktiv bist, darfst und solltest du eine größere Menge an Kohlenhydraten verzehren als an Tagen, an denen du körperlich inaktiv bist. Fazit Die glykämische Reaktion bzw. der Blutzuckeranstieg nach einer verzehrten Mahlzeit ist höchst individuell und variiert von Person zu Person teilweise stark. Es spielen Einflussfaktoren wie beispielsweise die Mahlzeiten, Zusammensetzung und -zubereitung, Bewegungsverhalten, Schlaf und die Tageszeit (zu der die Mahlzeit eingenommen wird) eine Rolle. Die ermittelten Werte eines CGM-Sensors sollten nicht auf die „Goldwaage“ gelegt werden. Für Menschen mit einer Insulinresistenz oder auch im Sport, könnten sie als grober Richtwert durchaus sinnvoll sein. Menschen, die beim Tragen eines Sensors übermäßig häufig die gemessenen Werte tracken und bei erhöhten Werten (die im Normbereich liegen) psychisch negativ beeinflusst werden, sollten CGM-Sensoren nicht nutzen. Quellen: Zeevi D, Korem T, Zmora N, Israeli D, Rothschild D, Weinberger A, Ben-Yacov O, Lador D, Avnit-Sagi T, Lotan-Pompan M, Suez J, Mahdi JA, Matot E, Malka G, Kosower N, Rein M, Zilberman-Schapira G, Dohnalová L, Pevsner-Fischer M, Bikovsky R, Halpern Z, Elinav E, Segal E (2015): Personalized Nutrition by Prediction of Glycemic Responses. Cell; 163(5):1079-1094 Hutchins KM, Betts JA, Thompson D, Hengist A, Gonzalez JT (2025): Continuous glucose monitor overestimates glycemia, with the magnitude of bias varying by postprandial test and individual - a randomized crossover trial. Am J Clin Nutr, S0002-9165(25)00092-9
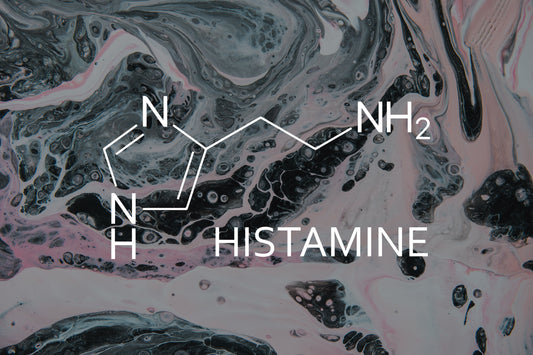
Histamin
Was ist Histamin? Histamin ist ein Gewebshormon und Neurotransmitter, das der Körper selbstständig unter anderem in sogenannten „Mastzellen“ herstellen und speichern kann. Histamin kommt in fast allen menschlichen Geweben vor. Die höchste Konzentration befindet sich in Haut, Lunge und im Magen-Darm-Trakt. Ohne Histamin wäre ein Überleben nicht möglich. Histamin unterstützt das Immunsystem, indem es unter anderem zur Weitung der Blutgefäße führt, sodass mehr Immunzellen in das betroffene Gewebe gelangen. Histamin in der Ernährung Histamin wird nicht nur vom Körper selbst gebildet, sondern auch über die Ernährung aufgenommen. Histaminreiche Lebensmittel sind vor allem fermentierte oder lang gereifte und gelagerte Lebensmittel wie Sauerkraut, Kimchi, Essig, lang gereifter Käse oder Salami. Auch der Konsum von Rotwein, Weizenbier, Spinat, Kakao, Thunfisch, Sardine, oder Makrele kann zu Problemen bei einem Ungleichgewicht der Histaminproduktion bzw. der Histaminaufnahme und des -abbaus führen. Dieses Ungleichgewicht wird häufig als „Histaminintoleranz“ beschrieben. Gibt es eine „Histaminintoleranz“ wirklich?! Eine „Histaminintoleranz“ gibt es nicht wirklich. Wird hiervon gesprochen, handelt es sich häufig um ein gerade angesprochenes Ungleichgewicht zwischen vorhandenem Histamin und dessen Abbau. Symptome bei einem Ungleichgewicht können Urtikaria, Juckreiz, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Blähbauch, Diarrhoe, Kopfschmerzen, Schwindel, Herzrhythmusstörungen, Fließschnupfen und Asthmaanfälle sein. Der Körper verfügt über verschiedene Mechanismen, Histamin abzubauen. Im Darm wird Histamin durch ein Enzym, die sogenannte Diaminoxidase (DAO), abgebaut. Liegen Mikronährstoffmängel vor, kann die DAO jedoch nicht effizient genug arbeiten. Neben der DAO im Darm gibt es eine DAO im Blut. Des Weiteren kann Histamin z.B. in der Leber abgebaut werden. Diagnostik einer „Histaminintoleranz“ Um eine „Histaminintoleranz“ zu diagnostizieren, wird häufig die DAO-Konzentration im Serum (Blut) oder das Serum Histamin bestimmt. Diese Methoden sind jedoch unzureichend und unzuverlässig. Eine genaue Anamnese und das Ansprechen auf eine histaminarme Ernährung bei vorheriger Ausschlussdiagnostik sollte bevorzugt werden. Neben Mikronährstoffmängeln können auch andere Ursachen für ein Ungleichgewicht zwischen vorhandenem Histamin und dessen Abbau verantwortlich sein. Oftmals ist ein sogenanntes Mastzellaktivierungssyndrom ursächlich, dessen Behandlung im Vordergrund stehen sollte. Trigger für eine Mastzellaktivierung können beispielsweise physischer und psychischer Stress, toxische Belastungen, hormonelle Störungen, Medikamente oder chronische Infektionen sein Quelle: Kauffmann K (2021): Histaminintoleranz gibt es nicht – für ein ganzheitliches Verständnis von Histamin und Mastzellaktivierung. In: OM & Ernährung, Nr. 176
Histamin
Was ist Histamin? Histamin ist ein Gewebshormon und Neurotransmitter, das der Körper selbstständig unter anderem in sogenannten „Mastzellen“ herstellen und speichern kann. Histamin kommt in fast allen menschlichen Geweben vor. Die höchste Konzentration befindet sich in Haut, Lunge und im Magen-Darm-Trakt. Ohne Histamin wäre ein Überleben nicht möglich. Histamin unterstützt das Immunsystem, indem es unter anderem zur Weitung der Blutgefäße führt, sodass mehr Immunzellen in das betroffene Gewebe gelangen. Histamin in der Ernährung Histamin wird nicht nur vom Körper selbst gebildet, sondern auch über die Ernährung aufgenommen. Histaminreiche Lebensmittel sind vor allem fermentierte oder lang gereifte und gelagerte Lebensmittel wie Sauerkraut, Kimchi, Essig, lang gereifter Käse oder Salami. Auch der Konsum von Rotwein, Weizenbier, Spinat, Kakao, Thunfisch, Sardine, oder Makrele kann zu Problemen bei einem Ungleichgewicht der Histaminproduktion bzw. der Histaminaufnahme und des -abbaus führen. Dieses Ungleichgewicht wird häufig als „Histaminintoleranz“ beschrieben. Gibt es eine „Histaminintoleranz“ wirklich?! Eine „Histaminintoleranz“ gibt es nicht wirklich. Wird hiervon gesprochen, handelt es sich häufig um ein gerade angesprochenes Ungleichgewicht zwischen vorhandenem Histamin und dessen Abbau. Symptome bei einem Ungleichgewicht können Urtikaria, Juckreiz, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Blähbauch, Diarrhoe, Kopfschmerzen, Schwindel, Herzrhythmusstörungen, Fließschnupfen und Asthmaanfälle sein. Der Körper verfügt über verschiedene Mechanismen, Histamin abzubauen. Im Darm wird Histamin durch ein Enzym, die sogenannte Diaminoxidase (DAO), abgebaut. Liegen Mikronährstoffmängel vor, kann die DAO jedoch nicht effizient genug arbeiten. Neben der DAO im Darm gibt es eine DAO im Blut. Des Weiteren kann Histamin z.B. in der Leber abgebaut werden. Diagnostik einer „Histaminintoleranz“ Um eine „Histaminintoleranz“ zu diagnostizieren, wird häufig die DAO-Konzentration im Serum (Blut) oder das Serum Histamin bestimmt. Diese Methoden sind jedoch unzureichend und unzuverlässig. Eine genaue Anamnese und das Ansprechen auf eine histaminarme Ernährung bei vorheriger Ausschlussdiagnostik sollte bevorzugt werden. Neben Mikronährstoffmängeln können auch andere Ursachen für ein Ungleichgewicht zwischen vorhandenem Histamin und dessen Abbau verantwortlich sein. Oftmals ist ein sogenanntes Mastzellaktivierungssyndrom ursächlich, dessen Behandlung im Vordergrund stehen sollte. Trigger für eine Mastzellaktivierung können beispielsweise physischer und psychischer Stress, toxische Belastungen, hormonelle Störungen, Medikamente oder chronische Infektionen sein Quelle: Kauffmann K (2021): Histaminintoleranz gibt es nicht – für ein ganzheitliches Verständnis von Histamin und Mastzellaktivierung. In: OM & Ernährung, Nr. 176

Blaulicht und Hautgesundheit
Die Haut – eines unserer Schutzschilder zur Außenwelt Die Haut schützt unseren Körper vor Einflüssen der Außenwelt. Sie ist nicht nur unter anderem Umweltbelastungen, UV-Strahlung sowie Keimen, sondern auf Grund der zunehmenden Nutzung elektronischer Geräte, einschließlich Innenbeleuchtung und digitaler Geräte wie Laptops, Tablets, oder Smartphones, blauem Licht ausgesetzt. Veränderungen der Lichtverhältnisse Menschen sind seit jeher unterschiedlichen Mengen an (für das menschliche Auge) sichtbarem und unsichtbarem Licht ausgesetzt. Das sichtbare Lichtspektrum besteht aus den Farben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett. Infrarotlicht sowie ultraviolettes (UV-)Licht sind für das menschliche Auge nicht sichtbar. Durch unter anderem die Industrialisierung, sind Menschen in der heutigen Zeit tagsüber und nachts übermäßig künstlichem Licht ausgesetzt. Tagsüber erhalten viele auf Grund ihres Berufs nicht ausreichend natürliches Licht. Die Haut ist als „Hülle des Körpers“, unmittelbar sowohl künstlichem als auch Umgebungslicht und äußeren Einflüssen ausgesetzt. Dies kann sich negativ auf die Hautgesundheit auswirken. Wie wirkt sich blaues Licht von digitalen Bildschirmen auf die Haut aus? Dass blaues Licht sich negativ auf den sogenannten „Schlaf-Wach-Rhythmus“ (zirkadianer Rhythmus) auswirken kann, ist schon des längeren bekannt. Studien konnten nun zudem aufzeigen, dass blaues Licht den Alterungsprozess der Haut beschleunigen und eine Hauthyperpigmentierung hervorrufen kann. Der genaue Prozess ist noch nicht vollständig bekannt. Hochintensives blaues Licht kann tiefer in die Haut dringen als UVB- und UVA-Strahlen. So kann die regelmäßige Exposition gegenüber blauem Licht, Hautzellen verschiedener „Hautschichten“ dauerhaft schädigen. Dies kann zu einer Beschleunigung des Alterungsprozesses beitragen. Sonne vs. Bildschirm Die Hauptquelle für blaues Licht ist Sonnenlicht. Zudem erzeugen LEDs beträchtliche Mengen an blauem Licht. Auf Grund der Nähe zum Bildschirm und der Dauer der Zeit, in der auf Bildschirmen geschaut wird, gibt es zunehmende Bedenken hinsichtlich der langfristigen gesundheitlichen Folgen, auch wenn die Auswirkungen des von Bildschirmen erzeugten blauen Lichts geringer sind als die der Sonneneinstrahlung. Ist blaues Licht immer schädlich? Blaues Licht kann sich nicht nur negativ, sondern auch positiv auf die Hautgesundheit auswirken. So kann eine Blaulichttherapie beispielsweise bei atopischer Dermatitis, Akne oder leichter bis mittelschwerer Plaque-Psoriasis eingesetzt werden. Quelle: Kumari J, Das K, Babaei M, Rokni GR, Goldust M (2023): The impact of blue light and digital screens on the skin. J Cosmet Dermatol, 22(4):1185-1190
Blaulicht und Hautgesundheit
Die Haut – eines unserer Schutzschilder zur Außenwelt Die Haut schützt unseren Körper vor Einflüssen der Außenwelt. Sie ist nicht nur unter anderem Umweltbelastungen, UV-Strahlung sowie Keimen, sondern auf Grund der zunehmenden Nutzung elektronischer Geräte, einschließlich Innenbeleuchtung und digitaler Geräte wie Laptops, Tablets, oder Smartphones, blauem Licht ausgesetzt. Veränderungen der Lichtverhältnisse Menschen sind seit jeher unterschiedlichen Mengen an (für das menschliche Auge) sichtbarem und unsichtbarem Licht ausgesetzt. Das sichtbare Lichtspektrum besteht aus den Farben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett. Infrarotlicht sowie ultraviolettes (UV-)Licht sind für das menschliche Auge nicht sichtbar. Durch unter anderem die Industrialisierung, sind Menschen in der heutigen Zeit tagsüber und nachts übermäßig künstlichem Licht ausgesetzt. Tagsüber erhalten viele auf Grund ihres Berufs nicht ausreichend natürliches Licht. Die Haut ist als „Hülle des Körpers“, unmittelbar sowohl künstlichem als auch Umgebungslicht und äußeren Einflüssen ausgesetzt. Dies kann sich negativ auf die Hautgesundheit auswirken. Wie wirkt sich blaues Licht von digitalen Bildschirmen auf die Haut aus? Dass blaues Licht sich negativ auf den sogenannten „Schlaf-Wach-Rhythmus“ (zirkadianer Rhythmus) auswirken kann, ist schon des längeren bekannt. Studien konnten nun zudem aufzeigen, dass blaues Licht den Alterungsprozess der Haut beschleunigen und eine Hauthyperpigmentierung hervorrufen kann. Der genaue Prozess ist noch nicht vollständig bekannt. Hochintensives blaues Licht kann tiefer in die Haut dringen als UVB- und UVA-Strahlen. So kann die regelmäßige Exposition gegenüber blauem Licht, Hautzellen verschiedener „Hautschichten“ dauerhaft schädigen. Dies kann zu einer Beschleunigung des Alterungsprozesses beitragen. Sonne vs. Bildschirm Die Hauptquelle für blaues Licht ist Sonnenlicht. Zudem erzeugen LEDs beträchtliche Mengen an blauem Licht. Auf Grund der Nähe zum Bildschirm und der Dauer der Zeit, in der auf Bildschirmen geschaut wird, gibt es zunehmende Bedenken hinsichtlich der langfristigen gesundheitlichen Folgen, auch wenn die Auswirkungen des von Bildschirmen erzeugten blauen Lichts geringer sind als die der Sonneneinstrahlung. Ist blaues Licht immer schädlich? Blaues Licht kann sich nicht nur negativ, sondern auch positiv auf die Hautgesundheit auswirken. So kann eine Blaulichttherapie beispielsweise bei atopischer Dermatitis, Akne oder leichter bis mittelschwerer Plaque-Psoriasis eingesetzt werden. Quelle: Kumari J, Das K, Babaei M, Rokni GR, Goldust M (2023): The impact of blue light and digital screens on the skin. J Cosmet Dermatol, 22(4):1185-1190

Gallensäuren
Gallensäuren: Unverzichtbar für die Fettverdauung Gallensäuren sind ein entscheidender Bestandteil der Galle, die in der Leber produziert und in der Gallenblase gespeichert wird. Sie spielen eine zentrale Rolle bei der Verdauung von Fetten, indem sie diese in eine Form umwandeln, die vom Körper leichter aufgenommen werden kann. Ohne Gallensäuren könnte der Körper Fette nicht effizient verwerten, was zu erheblichen Mangelerscheinungen und Verdauungsproblemen führen würde. Wie Gallensäuren die Fettverdauung unterstützen Gallensäuren wirken wie Emulgatoren. Sie helfen, große Fettmoleküle in kleinere Tröpfchen zu zerlegen. Diese Emulgierung sorgt dafür, dass die Lipasen (Enzyme, die für die Fettverdauung notwendig sind) die Fette in kleine Bestandteile abbauen können. Nachdem die Fette in kleinere Teile aufgespalten wurden, können sie im Dünndarm aufgenommen werden. Die aufgenommenen Fette gelangen zunächst mit Hilfe von Transportproteinen in die Lymphe und erst dann in den Blutkreislauf. Die Rolle der Gallensäuren bei der Verdauung fettlöslicher Vitamine Gallensäuren sind nicht nur für die Verdauung von Fetten entscheidend, sondern auch für die Aufnahme von fettlöslichen Vitaminen. Vitamine A, D, E und K benötigen Gallensäuren, um in den Darmzellen aufgenommen zu werden. Ein Mangel an Gallensäuren oder eine gestörte Gallensekretion kann daher zu Mangelerscheinungen dieser Vitamine führen. Regulation der Gallensäuren und ihre Rückresorption Nachdem Gallensäuren bei der Fettverdauung im Dünndarm geholfen haben, werden sie im letzten Dünndarmabschnitt größtenteils wieder in den Blutkreislauf aufgenommen und zur Leber zurückgeführt. Dieser sogenannte „enterohepatische Kreislauf“ sorgt dafür, dass Gallensäuren effizient recycelt werden und nicht erneut gebildet werden müssen. Fazit Gallensäuren sind unverzichtbar für die Fettverdauung und die Aufnahme fettlöslicher Vitamine. Sie ermöglichen es dem Körper, Fette effizient zu verarbeiten und essentielle Nährstoffe aus der Nahrung zu gewinnen. Eine Störung der Gallensäureproduktion oder -ausschüttung kann zu schweren Verdauungsproblemen führen und die Aufnahme lebenswichtiger Nährstoffe beeinträchtigen. Die Gesundheit des Gallensystems ist daher entscheidend für eine gute Verdauung und eine optimale Nährstoffversorgung des Körpers. Quellen: Biesalski HK, Bischoff SC, Pirlich M, Weimann A (2018): Ernährungsmedizin. Nach dem Curriculum Ernährungsmedizin der Bundesärztekammer. 5., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Georg Thieme Verlag KG Chiang JY (2013): Bile acid metabolism and signaling. Compr Physiol, 3(3):1191-212 Chiang JYL, Ferrell JM (2018): Bile Acid Metabolism in Liver Pathobiology. Gene Expr, 18(2):71-87
Gallensäuren
Gallensäuren: Unverzichtbar für die Fettverdauung Gallensäuren sind ein entscheidender Bestandteil der Galle, die in der Leber produziert und in der Gallenblase gespeichert wird. Sie spielen eine zentrale Rolle bei der Verdauung von Fetten, indem sie diese in eine Form umwandeln, die vom Körper leichter aufgenommen werden kann. Ohne Gallensäuren könnte der Körper Fette nicht effizient verwerten, was zu erheblichen Mangelerscheinungen und Verdauungsproblemen führen würde. Wie Gallensäuren die Fettverdauung unterstützen Gallensäuren wirken wie Emulgatoren. Sie helfen, große Fettmoleküle in kleinere Tröpfchen zu zerlegen. Diese Emulgierung sorgt dafür, dass die Lipasen (Enzyme, die für die Fettverdauung notwendig sind) die Fette in kleine Bestandteile abbauen können. Nachdem die Fette in kleinere Teile aufgespalten wurden, können sie im Dünndarm aufgenommen werden. Die aufgenommenen Fette gelangen zunächst mit Hilfe von Transportproteinen in die Lymphe und erst dann in den Blutkreislauf. Die Rolle der Gallensäuren bei der Verdauung fettlöslicher Vitamine Gallensäuren sind nicht nur für die Verdauung von Fetten entscheidend, sondern auch für die Aufnahme von fettlöslichen Vitaminen. Vitamine A, D, E und K benötigen Gallensäuren, um in den Darmzellen aufgenommen zu werden. Ein Mangel an Gallensäuren oder eine gestörte Gallensekretion kann daher zu Mangelerscheinungen dieser Vitamine führen. Regulation der Gallensäuren und ihre Rückresorption Nachdem Gallensäuren bei der Fettverdauung im Dünndarm geholfen haben, werden sie im letzten Dünndarmabschnitt größtenteils wieder in den Blutkreislauf aufgenommen und zur Leber zurückgeführt. Dieser sogenannte „enterohepatische Kreislauf“ sorgt dafür, dass Gallensäuren effizient recycelt werden und nicht erneut gebildet werden müssen. Fazit Gallensäuren sind unverzichtbar für die Fettverdauung und die Aufnahme fettlöslicher Vitamine. Sie ermöglichen es dem Körper, Fette effizient zu verarbeiten und essentielle Nährstoffe aus der Nahrung zu gewinnen. Eine Störung der Gallensäureproduktion oder -ausschüttung kann zu schweren Verdauungsproblemen führen und die Aufnahme lebenswichtiger Nährstoffe beeinträchtigen. Die Gesundheit des Gallensystems ist daher entscheidend für eine gute Verdauung und eine optimale Nährstoffversorgung des Körpers. Quellen: Biesalski HK, Bischoff SC, Pirlich M, Weimann A (2018): Ernährungsmedizin. Nach dem Curriculum Ernährungsmedizin der Bundesärztekammer. 5., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Georg Thieme Verlag KG Chiang JY (2013): Bile acid metabolism and signaling. Compr Physiol, 3(3):1191-212 Chiang JYL, Ferrell JM (2018): Bile Acid Metabolism in Liver Pathobiology. Gene Expr, 18(2):71-87

Vitalpilze
Vitalpilze in der Mykotherapie Vor allem in der traditionellen chinesischen Medizin haben Vitalpilze eine lange Tradition, um verschiedene Erkrankungen zu behandeln und die Gesundheit und Langlebigkeit zu fördern. Zusammengefasst wird das Ganze unter der sogenannten „Mykotherapie“. Vitalpilze sind aber nicht nur im asiatischen Raum, sondern seit einigen Jahren auch in der Biohacking-Szene, vor allem zur Steigerung der Performance, sehr beliebt. Wichtig vorab zu klären ist, dass es sich bei Vitalpilzen nicht um halluzinogen wirkende Pilze handelt. Sie stellen zudem keine Medikamente, sondern (wenn sie in Kapseln oder in Form von Tropfen vertrieben werden) Nahrungsergänzungsmittel dar. Das bedeutet, sie sollten nicht als alleinige Therapie, sondern ausschließlich als adjuvante (begleitende) Therapie eingesetzt werden. Welche Pilze zählen zu den Vitalpilzen? Einige der gängigsten Vitalpilze sind Pilze wie: Reishi, Cordyceps, Chaga, Löwenmähne, Shiitake, oder Maitake. Sie enthalten eine Reihe von Mikronährstoffen und Polysacchariden (u.a. ß-Glucane), die für die vielfältigen Wirkungen verantwortlich gemacht werden. Vitalpilze in der Therapie von leichten, kognitiven Beeinträchtigungen Vitalpilze sind unter anderem für ihre antidiabetischen, antimikrobiellen, antiviralen und ausgewählten anti karzinogenen Eigenschaften bekannt. Auch für die Verbesserung von kognitiven Eigenschaften sollen sie eingesetzt werden können. Mit letzterem hat sich eine doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Studie befasst, die an 50-80-jährigen japanischen Männern und Frauen, mit leichter kognitive Beeinträchtigung durchgeführt wurde. Die Studie untersuchte die Wirksamkeit der oralen Verabreichung von Löwenmähne zur Verbesserung der kognitiven Beeinträchtigung. Hierfür wurde eine kognitive Funktionsskala verwendet. Bei einer doppelblinden, randomisierten, placebokontrollierten Studie werden die Studienteilnehmer per Zufall in zwei Gruppen (Behandlungsgruppe und Placebogruppe) eingeteilt. Weder die Studienteilnehmer noch der Arzt wissen, welche Personen das Placebo und welche Personen den Wirkstoff einnehmen. Die Studienteilnehmer der Behandlungsgruppe nahmen 16 Wochen lang Trockenpulver der Löwenmähne ein. Nach Beendigung der Einnahme wurden die Probanden weitere vier Wochen beobachtet. Die Behandlungsgruppe zeigte im Vergleich der Placebogruppe in den Wochen 8, 12 und 16 signifikant höhere Werte auf der kognitiven Funktionsskala. Vier Wochen nach Beendigung der 16-wöchigen Einnahme nahmen die Werte jedoch deutlich ab. Nebenwirkungen konnten keine nachgewiesen werden. Die Studie deutet bei einer regelmäßigen und vor allem langfristigen Einnahme von Löwenmähne auf eine Wirksamkeit bei der Verbesserung leichter kognitiver Beeinträchtigungen hin. Vitalpilze in der Krebstherapie Vor allem in Japan und China werden verschiedene Polysaccharide (vor allem ß-Glucane) aus Pilzen, die in klinischen Studien getestet wurden, in der adjuvanten Behandlung mit konventioneller Chemo- oder Strahlentherapie zur Behandlung von Krebserkrankungen eingesetzt. Es wurde festgestellt, dass ihre Einbeziehung Nebenwirkungen der konventionellen Behandlung minimieren und sich gleichzeitig positiv auf das Immunsystem auswirken kann. Der spezifische molekulare Mechanismus, der dahinter steht, ist jedoch noch nicht ganz geklärt. Vermutet wird, dass sie die Immunantwort verstärken können. Die Mykotherapie ist eine der vielversprechendsten integrativen Methoden zur Krebsbehandlung. Die Strategie scheint mehrere Vorteile zu bieten: Darunter eine Erhöhung der Gesamtansprechrate während der onkologischen Therapie, eine verbesserte Immunität und eine Verringerung einiger Nebenwirkungen der Chemotherapie. Probleme der Mykotherapie Ein großes Problem ist, dass es vor allem an gut durchgeführten Studien an Menschen mit einer ausreichenden Teilnehmerzahl mangelt. In der Krebsforschung sollte zusätzlich darauf geachtet werden, Studien an unterschiedlichen Krebsarten durchzuführen. Ein weiteres Problem stellt die Aufbereitung der Polysaccharide aus den Pilzen dar. Die Extraktion und Isolierung von Polysacchariden bleiben (unter anderem auf Grund der geringen Wasserlöslichkeit) eine zentrale Herausforderung. Die gebräuchlichste Extraktion von Pilzpolysacchariden stellt die Heißwasserextraktion dar. Diese Methode erfordert jedoch eine lange Extraktionszeit bei hoher Temperatur, was wiederum die Struktur der Polysaccharide verändert und somit ihre Bio-Aktivitäten verringern kann. Auch bei anderen Methoden, wie z.B. ultraschall unterstützten Extraktionen, müssen gewisse Einschränkungen der Ansätze berücksichtigt werden. Eine weitere Option stellt die Kombination mehrerer Extraktionsmethoden zur Verbesserung der Ergebnisse dar. Diese sollte jedoch weiter optimiert und evaluiert werden. Quellen: Mori K, Inatomi S, Ouchi K, Azumi Y, Tuchida T (2009): Improving effects of the mushroom Yamabushitake (Hericium erinaceus) on mild cognitive impairment: a double-blind placebo-controlled clinical trial. Phytother Res, 23(3):367-72 Anusiya G, Gowthama Prabu U, Yamini NV, Sivarajasekar N, Rambabu K, Bharath G, Banat F (2021): A review of the therapeutic and biological effects of edible and wild mushrooms. Bioengineered, 12(2):11239-11268
Vitalpilze
Vitalpilze in der Mykotherapie Vor allem in der traditionellen chinesischen Medizin haben Vitalpilze eine lange Tradition, um verschiedene Erkrankungen zu behandeln und die Gesundheit und Langlebigkeit zu fördern. Zusammengefasst wird das Ganze unter der sogenannten „Mykotherapie“. Vitalpilze sind aber nicht nur im asiatischen Raum, sondern seit einigen Jahren auch in der Biohacking-Szene, vor allem zur Steigerung der Performance, sehr beliebt. Wichtig vorab zu klären ist, dass es sich bei Vitalpilzen nicht um halluzinogen wirkende Pilze handelt. Sie stellen zudem keine Medikamente, sondern (wenn sie in Kapseln oder in Form von Tropfen vertrieben werden) Nahrungsergänzungsmittel dar. Das bedeutet, sie sollten nicht als alleinige Therapie, sondern ausschließlich als adjuvante (begleitende) Therapie eingesetzt werden. Welche Pilze zählen zu den Vitalpilzen? Einige der gängigsten Vitalpilze sind Pilze wie: Reishi, Cordyceps, Chaga, Löwenmähne, Shiitake, oder Maitake. Sie enthalten eine Reihe von Mikronährstoffen und Polysacchariden (u.a. ß-Glucane), die für die vielfältigen Wirkungen verantwortlich gemacht werden. Vitalpilze in der Therapie von leichten, kognitiven Beeinträchtigungen Vitalpilze sind unter anderem für ihre antidiabetischen, antimikrobiellen, antiviralen und ausgewählten anti karzinogenen Eigenschaften bekannt. Auch für die Verbesserung von kognitiven Eigenschaften sollen sie eingesetzt werden können. Mit letzterem hat sich eine doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Studie befasst, die an 50-80-jährigen japanischen Männern und Frauen, mit leichter kognitive Beeinträchtigung durchgeführt wurde. Die Studie untersuchte die Wirksamkeit der oralen Verabreichung von Löwenmähne zur Verbesserung der kognitiven Beeinträchtigung. Hierfür wurde eine kognitive Funktionsskala verwendet. Bei einer doppelblinden, randomisierten, placebokontrollierten Studie werden die Studienteilnehmer per Zufall in zwei Gruppen (Behandlungsgruppe und Placebogruppe) eingeteilt. Weder die Studienteilnehmer noch der Arzt wissen, welche Personen das Placebo und welche Personen den Wirkstoff einnehmen. Die Studienteilnehmer der Behandlungsgruppe nahmen 16 Wochen lang Trockenpulver der Löwenmähne ein. Nach Beendigung der Einnahme wurden die Probanden weitere vier Wochen beobachtet. Die Behandlungsgruppe zeigte im Vergleich der Placebogruppe in den Wochen 8, 12 und 16 signifikant höhere Werte auf der kognitiven Funktionsskala. Vier Wochen nach Beendigung der 16-wöchigen Einnahme nahmen die Werte jedoch deutlich ab. Nebenwirkungen konnten keine nachgewiesen werden. Die Studie deutet bei einer regelmäßigen und vor allem langfristigen Einnahme von Löwenmähne auf eine Wirksamkeit bei der Verbesserung leichter kognitiver Beeinträchtigungen hin. Vitalpilze in der Krebstherapie Vor allem in Japan und China werden verschiedene Polysaccharide (vor allem ß-Glucane) aus Pilzen, die in klinischen Studien getestet wurden, in der adjuvanten Behandlung mit konventioneller Chemo- oder Strahlentherapie zur Behandlung von Krebserkrankungen eingesetzt. Es wurde festgestellt, dass ihre Einbeziehung Nebenwirkungen der konventionellen Behandlung minimieren und sich gleichzeitig positiv auf das Immunsystem auswirken kann. Der spezifische molekulare Mechanismus, der dahinter steht, ist jedoch noch nicht ganz geklärt. Vermutet wird, dass sie die Immunantwort verstärken können. Die Mykotherapie ist eine der vielversprechendsten integrativen Methoden zur Krebsbehandlung. Die Strategie scheint mehrere Vorteile zu bieten: Darunter eine Erhöhung der Gesamtansprechrate während der onkologischen Therapie, eine verbesserte Immunität und eine Verringerung einiger Nebenwirkungen der Chemotherapie. Probleme der Mykotherapie Ein großes Problem ist, dass es vor allem an gut durchgeführten Studien an Menschen mit einer ausreichenden Teilnehmerzahl mangelt. In der Krebsforschung sollte zusätzlich darauf geachtet werden, Studien an unterschiedlichen Krebsarten durchzuführen. Ein weiteres Problem stellt die Aufbereitung der Polysaccharide aus den Pilzen dar. Die Extraktion und Isolierung von Polysacchariden bleiben (unter anderem auf Grund der geringen Wasserlöslichkeit) eine zentrale Herausforderung. Die gebräuchlichste Extraktion von Pilzpolysacchariden stellt die Heißwasserextraktion dar. Diese Methode erfordert jedoch eine lange Extraktionszeit bei hoher Temperatur, was wiederum die Struktur der Polysaccharide verändert und somit ihre Bio-Aktivitäten verringern kann. Auch bei anderen Methoden, wie z.B. ultraschall unterstützten Extraktionen, müssen gewisse Einschränkungen der Ansätze berücksichtigt werden. Eine weitere Option stellt die Kombination mehrerer Extraktionsmethoden zur Verbesserung der Ergebnisse dar. Diese sollte jedoch weiter optimiert und evaluiert werden. Quellen: Mori K, Inatomi S, Ouchi K, Azumi Y, Tuchida T (2009): Improving effects of the mushroom Yamabushitake (Hericium erinaceus) on mild cognitive impairment: a double-blind placebo-controlled clinical trial. Phytother Res, 23(3):367-72 Anusiya G, Gowthama Prabu U, Yamini NV, Sivarajasekar N, Rambabu K, Bharath G, Banat F (2021): A review of the therapeutic and biological effects of edible and wild mushrooms. Bioengineered, 12(2):11239-11268

Ernährung auf Reisen
Auf Reisen (seien sie geschäftlicher oder privater Natur) unterscheidet sich das Ernährungsverhalten oftmals stark von den Essgewohnheiten, die im Alltag verfolgt werden. Im Folgenden wirst du fünf einfache Tipps an die Hand bekommen, um ein ausgewogenes und vielfältiges Ernährungsmuster auch auf Reisen sicherstellen zu können. Tipp 1: Gönn dir einen bunten Salat als Vorspeise Indem du mit einem bunten Salat die Mahlzeit beginnst, versorgst du deinen Körper mit Ballaststoffen und Mikronährstoffen. Außerdem füllst du deinen Magen, wodurch du schneller satt sein wirst und im Umkehrschluss höchstwahrscheinlich weniger von der Hauptmahlzeit (oder dem Nachtisch) essen wirst. Ballaststoffe halten dich zudem länger satt. Tipp 2: Achte auf genügend Eiweiß Neben Ballaststoffen ist vor allem eines für eine lange Sättigung entscheidend: Eine ausreichende Aufnahme von Eiweiß. Achte darauf, in jeder deiner Mahlzeiten hochwertige Eiweißkomponenten enthalten zu haben. Tipp 3: Habe gesunde Snacks griffbereit Gesunde Snacks wie ungesalzene, naturbelassene Nüsse – seien es Walnüsse, Mandeln, Pistazien, oder Pekannüsse – griffbereit zu haben, kann dir helfen einen klaren Kopf zu bewahren, wenn der Hunger kommt und es schnell gehen. In diesen Situationen wird häufig zu fettigen oder süßen Fertigprodukten gegriffen, um den Hunger schnell zu stillen. Auf Reisen kommt häufig das Problem dazu, dass nicht immer eine gesündere Alternative zur Verfügung steht. Hier können gesunde Snacks ein wahrer Game Changer sein. Tipp 4: Buffet bedeutet nicht „all you can eat“ Nur weil ein Buffet im Hotel vorhanden ist, heißt es noch lange nicht, dass du so viel essen sollst, bis du deinen Gürtel um ein Loch weiten musst. Oftmals sind die Augen bei einem Buffet größer als der Magen. Bevor du dir also beim ersten Durchlauf den Teller so belädst, dass kaum mehr etwas darauf passt, nimm dir lieber kleinere Portionen und laufe zwei oder dreimal, falls du noch hungrig bist. Zum einen wird so weniger Essen entsorgt (falls du nicht alles aufessen kannst), zum anderen kannst du besser auf dein Hunger- und Sättigungsgefühl hören, indem du immer wieder in dich gehst und spürst, ob du wirklich noch Hunger oder eher Appetit hast. Tipp 5: Teile dein Dessert Falls du nicht allein im Urlaub bist und auf ein tägliches Dessert nicht verzichten möchtest, dann teile dieses mit deinem Partner / deiner Partnerin, Freund / Freundin oder Familie. Denn sind wir mal ehrlich, in den meisten Fällen reichen bereits ein paar Bissen des Desserts aus, um die Gelüste zu befriedigen. Das ganze Dessert zu verspeisen ist oftmals gar nicht notwendig.
Ernährung auf Reisen
Auf Reisen (seien sie geschäftlicher oder privater Natur) unterscheidet sich das Ernährungsverhalten oftmals stark von den Essgewohnheiten, die im Alltag verfolgt werden. Im Folgenden wirst du fünf einfache Tipps an die Hand bekommen, um ein ausgewogenes und vielfältiges Ernährungsmuster auch auf Reisen sicherstellen zu können. Tipp 1: Gönn dir einen bunten Salat als Vorspeise Indem du mit einem bunten Salat die Mahlzeit beginnst, versorgst du deinen Körper mit Ballaststoffen und Mikronährstoffen. Außerdem füllst du deinen Magen, wodurch du schneller satt sein wirst und im Umkehrschluss höchstwahrscheinlich weniger von der Hauptmahlzeit (oder dem Nachtisch) essen wirst. Ballaststoffe halten dich zudem länger satt. Tipp 2: Achte auf genügend Eiweiß Neben Ballaststoffen ist vor allem eines für eine lange Sättigung entscheidend: Eine ausreichende Aufnahme von Eiweiß. Achte darauf, in jeder deiner Mahlzeiten hochwertige Eiweißkomponenten enthalten zu haben. Tipp 3: Habe gesunde Snacks griffbereit Gesunde Snacks wie ungesalzene, naturbelassene Nüsse – seien es Walnüsse, Mandeln, Pistazien, oder Pekannüsse – griffbereit zu haben, kann dir helfen einen klaren Kopf zu bewahren, wenn der Hunger kommt und es schnell gehen. In diesen Situationen wird häufig zu fettigen oder süßen Fertigprodukten gegriffen, um den Hunger schnell zu stillen. Auf Reisen kommt häufig das Problem dazu, dass nicht immer eine gesündere Alternative zur Verfügung steht. Hier können gesunde Snacks ein wahrer Game Changer sein. Tipp 4: Buffet bedeutet nicht „all you can eat“ Nur weil ein Buffet im Hotel vorhanden ist, heißt es noch lange nicht, dass du so viel essen sollst, bis du deinen Gürtel um ein Loch weiten musst. Oftmals sind die Augen bei einem Buffet größer als der Magen. Bevor du dir also beim ersten Durchlauf den Teller so belädst, dass kaum mehr etwas darauf passt, nimm dir lieber kleinere Portionen und laufe zwei oder dreimal, falls du noch hungrig bist. Zum einen wird so weniger Essen entsorgt (falls du nicht alles aufessen kannst), zum anderen kannst du besser auf dein Hunger- und Sättigungsgefühl hören, indem du immer wieder in dich gehst und spürst, ob du wirklich noch Hunger oder eher Appetit hast. Tipp 5: Teile dein Dessert Falls du nicht allein im Urlaub bist und auf ein tägliches Dessert nicht verzichten möchtest, dann teile dieses mit deinem Partner / deiner Partnerin, Freund / Freundin oder Familie. Denn sind wir mal ehrlich, in den meisten Fällen reichen bereits ein paar Bissen des Desserts aus, um die Gelüste zu befriedigen. Das ganze Dessert zu verspeisen ist oftmals gar nicht notwendig.

B-Vitamine im Sport
B-Vitamine B-Vitamine sind essentiell für den menschlichen Körper. Sie können (außer Vitamin B12) nicht langfristig vom Körper gespeichert werden, wodurch sie kontinuierlich in ausreichenden Mengen über die Ernährung aufgenommen werden müssen. B-Vitamine nehmen entscheidende Aufgaben unter anderem in der Energiegewinnung ein. B-Vitamine im Sport Vitamin B1, Vitamin B2 und Vitamin B6 sind entscheidend für die „Atmungskette“ innerhalb der Zellen, mit deren Hilfe Energie produziert wird. Folsäure/Folat (Vitamin B9) sowie Vitamin B12 sind für die Bildung neuer Zellen und für die Reparatur beschädigter Zellen von Bedeutung. Zudem sind sie für die Bildung roter Blutkörperchen entscheidend, weshalb ein Mangel an Vitamin B9, sowie an Vitamin B12 zu Blutarmut führen kann. Rote Blutkörperchen sind für den Transport von Sauerstoff durch den Körper und somit unter anderem für die Leistungsfähigkeit im Sport entscheidend. Haben Sportler einen erhöhten Bedarf an B-Vitaminen? Athleten haben tatsächlich einen erhöhten Bedarf an B-Vitaminen, der über mehrere Wege zustande kommt. Die intensive körperliche Belastung führt häufig zu einer verstärkten Ausscheidung von B-Vitaminen. Darüber hinaus nehmen sie entscheidende Rollen beim Aufbau und der Reparatur von Muskelgewebe und somit der Regeneration nach dem Training ein. Sollte jeder B-Vitamine supplementieren? Athleten haben einen erhöhten Bedarf an gewissen Nährstoffen und sind daher auf eine ausreichende Aufnahme von nährstoff- und energiedichten Mahlzeiten angewiesen. Obwohl ein „Food First“-Ansatz, das bedeutet, dass die Nährstoffe zunächst über die Ernährung gedeckt werden sollten, das Hauptziel ist, kann es in bestimmten Situationen, erforderlich sein, dass der Sporttreibende einen Vitamin- oder Mineralstoff Präparat einnimmt, um den täglichen Bedarf zu decken. Der Versorgungsstatus sollte somit regelmäßig bestimmt werden, um bei Bedarf individuell die Einnahme eines Vitaminpräparats wie B-Vitamine in Betracht zu ziehen. Achte auf eine hohe Qualität Bei der Supplementation von B-Vitaminen solltest du darauf achten, diese im Optimalfall in Form eines Komplexes zu dir zu nehmen, der ausreichend dosiert, jedoch nicht stark überdosiert ist und keine unnötigen Füll- und Zusatzstoffe enthält. Darüber hinaus sollten Vitamin-Formen enthalten sein, die eine hohe Bioverfügbarkeit aufweisen. Lasse dich hierfür beispielsweise von einer Ökotrophologin beraten.
B-Vitamine im Sport
B-Vitamine B-Vitamine sind essentiell für den menschlichen Körper. Sie können (außer Vitamin B12) nicht langfristig vom Körper gespeichert werden, wodurch sie kontinuierlich in ausreichenden Mengen über die Ernährung aufgenommen werden müssen. B-Vitamine nehmen entscheidende Aufgaben unter anderem in der Energiegewinnung ein. B-Vitamine im Sport Vitamin B1, Vitamin B2 und Vitamin B6 sind entscheidend für die „Atmungskette“ innerhalb der Zellen, mit deren Hilfe Energie produziert wird. Folsäure/Folat (Vitamin B9) sowie Vitamin B12 sind für die Bildung neuer Zellen und für die Reparatur beschädigter Zellen von Bedeutung. Zudem sind sie für die Bildung roter Blutkörperchen entscheidend, weshalb ein Mangel an Vitamin B9, sowie an Vitamin B12 zu Blutarmut führen kann. Rote Blutkörperchen sind für den Transport von Sauerstoff durch den Körper und somit unter anderem für die Leistungsfähigkeit im Sport entscheidend. Haben Sportler einen erhöhten Bedarf an B-Vitaminen? Athleten haben tatsächlich einen erhöhten Bedarf an B-Vitaminen, der über mehrere Wege zustande kommt. Die intensive körperliche Belastung führt häufig zu einer verstärkten Ausscheidung von B-Vitaminen. Darüber hinaus nehmen sie entscheidende Rollen beim Aufbau und der Reparatur von Muskelgewebe und somit der Regeneration nach dem Training ein. Sollte jeder B-Vitamine supplementieren? Athleten haben einen erhöhten Bedarf an gewissen Nährstoffen und sind daher auf eine ausreichende Aufnahme von nährstoff- und energiedichten Mahlzeiten angewiesen. Obwohl ein „Food First“-Ansatz, das bedeutet, dass die Nährstoffe zunächst über die Ernährung gedeckt werden sollten, das Hauptziel ist, kann es in bestimmten Situationen, erforderlich sein, dass der Sporttreibende einen Vitamin- oder Mineralstoff Präparat einnimmt, um den täglichen Bedarf zu decken. Der Versorgungsstatus sollte somit regelmäßig bestimmt werden, um bei Bedarf individuell die Einnahme eines Vitaminpräparats wie B-Vitamine in Betracht zu ziehen. Achte auf eine hohe Qualität Bei der Supplementation von B-Vitaminen solltest du darauf achten, diese im Optimalfall in Form eines Komplexes zu dir zu nehmen, der ausreichend dosiert, jedoch nicht stark überdosiert ist und keine unnötigen Füll- und Zusatzstoffe enthält. Darüber hinaus sollten Vitamin-Formen enthalten sein, die eine hohe Bioverfügbarkeit aufweisen. Lasse dich hierfür beispielsweise von einer Ökotrophologin beraten.

Eisen im Sport
Eisen Eisen ist ein essentielles Spurenelement. Es übt mehrere Funktionen im Körper aus und ist neben dem Sauerstofftransport unter anderem bei der Produktion von Energie und Neurotransmittern von entscheidender Bedeutung. Der Gesamtkörpergehalt an Eisen beträgt bei Männern etwa 4 g und bei Frauen 2,5 g. Eisen im Sport Eisenmangel ist sowohl bei männlichen als auch weiblichen Sporttreibenden nicht selten zu diagnostizieren. Eisenmangel ist einer der weltweit am häufigsten auftretenden Mängeln unter allen Mikronährstoffen. Vor allem menstruierende Frauen sind hiervon häufig betroffen. Im Sport sind vor allem jugendliche Sportlerinnen und Sporttreibende in Ausdauersportarten, oder Sportarten, die mit einer hohen Prävalenz für Essstörungen einherkommen, von Eisenmangel betroffen. Eisenmangel kann viele Organsysteme des Körpers und nicht nur den Sauerstofftransport beeinträchtigen. Warum haben Sportler ein erhöhtes Risiko für Eisenmangel? Die Hauptmechanismen, durch die Sport zu Eisenmangel führen kann, sind ein erhöhter Eisenbedarf, ein erhöhter Eisenverlust sowie die Blockierung der Eisenaufnahme. Symptome eines Eisenmangels Symptome eines Eisenmangels können unter anderem folgende sein: Blässe Müdigkeit/Ermüdung Haarausfall Rissige Mundwinkel Sollte jeder Eisen supplementieren? Regelmäßige Check-ups sind entscheidend, um individuell entscheiden zu können, ob eine Eisensubstitution notwendig ist. Eine langfristige tägliche orale Eiseneinnahme oder intravenöse Nahrungsergänzung bei normalen oder sogar hohen Ferritinwerten ist nicht sinnvoll und kann negative Folgen mit sich bringen. Die erste Maßnahme sollte stets die Erhöhung der Aufnahme von eisenreichen Lebensmitteln sein. Die Bioverfügbarkeit von Eisen hängt dabei nicht nur vom Lebensmittel selbst (tierisch oder pflanzlich), sondern auch von den tatsächlichen Eisenspeichern ab. Die Bioverfügbarkeit liegt zwischen 5-15 % und kann bei Eisenmangel auf etwa 35 % steigen. Eine Eisenmangelanämie kann in der Regel nicht allein durch die Ernährung korrigiert werden. Liegt bereits eine Anämie vor, sollte individuell mit Eisensupplementen oder intravenösen Gaben von Eisen gearbeitet werden.
Eisen im Sport
Eisen Eisen ist ein essentielles Spurenelement. Es übt mehrere Funktionen im Körper aus und ist neben dem Sauerstofftransport unter anderem bei der Produktion von Energie und Neurotransmittern von entscheidender Bedeutung. Der Gesamtkörpergehalt an Eisen beträgt bei Männern etwa 4 g und bei Frauen 2,5 g. Eisen im Sport Eisenmangel ist sowohl bei männlichen als auch weiblichen Sporttreibenden nicht selten zu diagnostizieren. Eisenmangel ist einer der weltweit am häufigsten auftretenden Mängeln unter allen Mikronährstoffen. Vor allem menstruierende Frauen sind hiervon häufig betroffen. Im Sport sind vor allem jugendliche Sportlerinnen und Sporttreibende in Ausdauersportarten, oder Sportarten, die mit einer hohen Prävalenz für Essstörungen einherkommen, von Eisenmangel betroffen. Eisenmangel kann viele Organsysteme des Körpers und nicht nur den Sauerstofftransport beeinträchtigen. Warum haben Sportler ein erhöhtes Risiko für Eisenmangel? Die Hauptmechanismen, durch die Sport zu Eisenmangel führen kann, sind ein erhöhter Eisenbedarf, ein erhöhter Eisenverlust sowie die Blockierung der Eisenaufnahme. Symptome eines Eisenmangels Symptome eines Eisenmangels können unter anderem folgende sein: Blässe Müdigkeit/Ermüdung Haarausfall Rissige Mundwinkel Sollte jeder Eisen supplementieren? Regelmäßige Check-ups sind entscheidend, um individuell entscheiden zu können, ob eine Eisensubstitution notwendig ist. Eine langfristige tägliche orale Eiseneinnahme oder intravenöse Nahrungsergänzung bei normalen oder sogar hohen Ferritinwerten ist nicht sinnvoll und kann negative Folgen mit sich bringen. Die erste Maßnahme sollte stets die Erhöhung der Aufnahme von eisenreichen Lebensmitteln sein. Die Bioverfügbarkeit von Eisen hängt dabei nicht nur vom Lebensmittel selbst (tierisch oder pflanzlich), sondern auch von den tatsächlichen Eisenspeichern ab. Die Bioverfügbarkeit liegt zwischen 5-15 % und kann bei Eisenmangel auf etwa 35 % steigen. Eine Eisenmangelanämie kann in der Regel nicht allein durch die Ernährung korrigiert werden. Liegt bereits eine Anämie vor, sollte individuell mit Eisensupplementen oder intravenösen Gaben von Eisen gearbeitet werden.

Zink im Sport
Zink – ein wichtiges Spurenelement Zink ist ein essentielles Spurenelement, das unter anderem eine entscheidende Rolle im Immunsystem, dem Energiestoffwechsel, der Wundheilung, antioxidativen Prozessen und der Fruchtbarkeit spielt. Eine unzureichende Versorgung mit dem Mineralstoff Zink kann unter anderem zu einer erhöhten Infektanfälligkeit führen. Zudem wird eine suboptimale Zinkversorgung mit einem erhöhten Risiko für chronische Erkrankungen wie Diabetes mellitus Typ 2 und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht. Achte als Sportler auf deine Zinkaufnahme Die Durchführung von Sport ist unerlässlich für die Gesundheit. Gleichzeitig stellt Sport eine Belastung für zahlreiche Körpersysteme dar, weswegen intensives Training mit einem erhöhten Risiko für Infektionen der oberen Atemwege einhergehen kann. Regelmäßig durchgeführte Trainingseinheiten führen zu Anpassungen des Herz-Kreislauf- und Muskel-Skelett-Systems. Für diese Anpassungen ist es jedoch nicht nur entscheidend, mit Nährstoffen wie Kohlenhydraten und Eiweiß, sondern auch mit Mikronährstoffen wie Zink ausreichend versorgt zu sein. Sportler weisen (auf Grund des Verlustes über den Schweiß) erhöhte Zinkverluste während der sportlichen Betätigung auf. Darüber hinaus scheint die körperliche Belastung selbst den Zinkstoffwechsel zu beeinflussen und zu reduzierten Zinkspiegeln für bis zu vier Stunden nach Beendigung der sportlichen Betätigung zu führen. Gesunde Ernährung hemmt die Zinkaufnahme?! Die Zinkaufnahme ist stark abhängig von der Phytat-Aufnahme (sekundärer Pflanzenstoff), der sich beispielsweise in Vollkorngetreide und Hülsenfrüchten befindet. Phytat bindet Zink im Magen-Darm-Trakt. Es entsteht ein unlöslicher Komplex, der nicht mehr vom Körper aufgenommen werden kann. Bei einer erhöhten Phytat-Zufuhr über die Ernährung sollte somit auf eine erhöhte Zinkaufnahme geachtet werden. Tipp: Durch Zubereitungsmethoden wie beispielsweise Einweichen oder Keimen kann Phytat abgebaut und die Bioverfügbarkeit von Zink erhöht werden. Auch die gleichzeitige Zufuhr von tierischem Protein erhöht die Bioverfügbarkeit von Zink. Fazit Sportler sollten auf Grund des erhöhten Zink-Verbrauchs auf eine ausreichende Zinkzufuhr achten und bei Bedarf supplementieren.
Zink im Sport
Zink – ein wichtiges Spurenelement Zink ist ein essentielles Spurenelement, das unter anderem eine entscheidende Rolle im Immunsystem, dem Energiestoffwechsel, der Wundheilung, antioxidativen Prozessen und der Fruchtbarkeit spielt. Eine unzureichende Versorgung mit dem Mineralstoff Zink kann unter anderem zu einer erhöhten Infektanfälligkeit führen. Zudem wird eine suboptimale Zinkversorgung mit einem erhöhten Risiko für chronische Erkrankungen wie Diabetes mellitus Typ 2 und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht. Achte als Sportler auf deine Zinkaufnahme Die Durchführung von Sport ist unerlässlich für die Gesundheit. Gleichzeitig stellt Sport eine Belastung für zahlreiche Körpersysteme dar, weswegen intensives Training mit einem erhöhten Risiko für Infektionen der oberen Atemwege einhergehen kann. Regelmäßig durchgeführte Trainingseinheiten führen zu Anpassungen des Herz-Kreislauf- und Muskel-Skelett-Systems. Für diese Anpassungen ist es jedoch nicht nur entscheidend, mit Nährstoffen wie Kohlenhydraten und Eiweiß, sondern auch mit Mikronährstoffen wie Zink ausreichend versorgt zu sein. Sportler weisen (auf Grund des Verlustes über den Schweiß) erhöhte Zinkverluste während der sportlichen Betätigung auf. Darüber hinaus scheint die körperliche Belastung selbst den Zinkstoffwechsel zu beeinflussen und zu reduzierten Zinkspiegeln für bis zu vier Stunden nach Beendigung der sportlichen Betätigung zu führen. Gesunde Ernährung hemmt die Zinkaufnahme?! Die Zinkaufnahme ist stark abhängig von der Phytat-Aufnahme (sekundärer Pflanzenstoff), der sich beispielsweise in Vollkorngetreide und Hülsenfrüchten befindet. Phytat bindet Zink im Magen-Darm-Trakt. Es entsteht ein unlöslicher Komplex, der nicht mehr vom Körper aufgenommen werden kann. Bei einer erhöhten Phytat-Zufuhr über die Ernährung sollte somit auf eine erhöhte Zinkaufnahme geachtet werden. Tipp: Durch Zubereitungsmethoden wie beispielsweise Einweichen oder Keimen kann Phytat abgebaut und die Bioverfügbarkeit von Zink erhöht werden. Auch die gleichzeitige Zufuhr von tierischem Protein erhöht die Bioverfügbarkeit von Zink. Fazit Sportler sollten auf Grund des erhöhten Zink-Verbrauchs auf eine ausreichende Zinkzufuhr achten und bei Bedarf supplementieren.

Raus aus der Müdigkeit
Ursachen für Müdigkeit Die Ursachen für Müdigkeit im Alltag sind multifaktoriell. Nicht nur Schlafmangel, sondern auch Dehydration, Stress, Bewegungsmangel sowie eine unausgewogene Ernährung können sich negativ auf dein Energielevel auswirken. Im Folgenden werden einzelne Nährstoffe vorgestellt, die unter anderem bei der Energiegewinnung unerlässlich sind. Eisen Eisen ist Bestandteil unseres roten Blutfarbstoffs, des sogenannten „Hämoglobins“, welches den durch die Atmung aufgenommenen Sauerstoff zu jeder einzelnen Zelle des menschlichen Körpers transportiert. Sauerstoff wird benötigt, um in den Zellen Energie zu produzieren. Ein Mangel an Eisen kann zur sogenannten Eisenmangelanämie führen. Diese Erkrankung geht häufig mit Müdigkeit und einer verminderten Leistungsfähigkeit einher. B-Vitamine B-Vitamine nehmen entscheidende Aufgaben in der Energiegewinnung der Mitochondrien („Kraftwerke“ der Zellen) ein. Sie arbeiten in ihrer Wirkweise eng zusammen, weshalb eine ausreichende Versorgung aller B-Vitamine vorliegen sollte. Vor allem Folat / Folsäure (Vitamin B9) und Vitamin B12 sind entscheidend für die Blutbildung und somit den Sauerstofftransport zu den Zellen. Vitamin D Ein Vitamin D-Mangel kann zu chronischer Müdigkeit und allgemeiner Erschöpfung führen. Um einen Mangel zu verhindern, sollte der individuelle Vitamin D-Spiegel in regelmäßigen Zeitabständen gemessen werden, um das fettlösliche Vitamin bei Bedarf zu substituieren. Coenzym Q10 Auch Coenzym Q10 nimmt eine Schlüsselrolle in der Energieproduktion ein. Im Laufe des Lebens nimmt die Eigenproduktion jedoch ab, was zu einer verminderten Energieproduktion in den Zellen führen kann. Ein niedriger Coenzym Q10-Spiegel wird mit einer verminderten körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit und Müdigkeit in Verbindung gebracht. Auch bei Personen, die Medikamente wie Statine (Cholesterinsenker) einnehmen, ist die Eigenproduktion reduziert. Fazit Mikronährstoffe sind unerlässlich in der Energieproduktion, weshalb eine ausreichende Versorgung sichergestellt werden sollte. Neben Eisen, B-Vitaminen, Vitamin D und Coenzym Q10 sind auch weitere Nährstoffe wie unter anderem Selen, Vitamin E und Zink für die Energiegewinnung entscheidend.
Raus aus der Müdigkeit
Ursachen für Müdigkeit Die Ursachen für Müdigkeit im Alltag sind multifaktoriell. Nicht nur Schlafmangel, sondern auch Dehydration, Stress, Bewegungsmangel sowie eine unausgewogene Ernährung können sich negativ auf dein Energielevel auswirken. Im Folgenden werden einzelne Nährstoffe vorgestellt, die unter anderem bei der Energiegewinnung unerlässlich sind. Eisen Eisen ist Bestandteil unseres roten Blutfarbstoffs, des sogenannten „Hämoglobins“, welches den durch die Atmung aufgenommenen Sauerstoff zu jeder einzelnen Zelle des menschlichen Körpers transportiert. Sauerstoff wird benötigt, um in den Zellen Energie zu produzieren. Ein Mangel an Eisen kann zur sogenannten Eisenmangelanämie führen. Diese Erkrankung geht häufig mit Müdigkeit und einer verminderten Leistungsfähigkeit einher. B-Vitamine B-Vitamine nehmen entscheidende Aufgaben in der Energiegewinnung der Mitochondrien („Kraftwerke“ der Zellen) ein. Sie arbeiten in ihrer Wirkweise eng zusammen, weshalb eine ausreichende Versorgung aller B-Vitamine vorliegen sollte. Vor allem Folat / Folsäure (Vitamin B9) und Vitamin B12 sind entscheidend für die Blutbildung und somit den Sauerstofftransport zu den Zellen. Vitamin D Ein Vitamin D-Mangel kann zu chronischer Müdigkeit und allgemeiner Erschöpfung führen. Um einen Mangel zu verhindern, sollte der individuelle Vitamin D-Spiegel in regelmäßigen Zeitabständen gemessen werden, um das fettlösliche Vitamin bei Bedarf zu substituieren. Coenzym Q10 Auch Coenzym Q10 nimmt eine Schlüsselrolle in der Energieproduktion ein. Im Laufe des Lebens nimmt die Eigenproduktion jedoch ab, was zu einer verminderten Energieproduktion in den Zellen führen kann. Ein niedriger Coenzym Q10-Spiegel wird mit einer verminderten körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit und Müdigkeit in Verbindung gebracht. Auch bei Personen, die Medikamente wie Statine (Cholesterinsenker) einnehmen, ist die Eigenproduktion reduziert. Fazit Mikronährstoffe sind unerlässlich in der Energieproduktion, weshalb eine ausreichende Versorgung sichergestellt werden sollte. Neben Eisen, B-Vitaminen, Vitamin D und Coenzym Q10 sind auch weitere Nährstoffe wie unter anderem Selen, Vitamin E und Zink für die Energiegewinnung entscheidend.

Enzyme für die Verdauung
Was sind Verdauungsenzyme Enzyme sind Proteine, die chemische Reaktionen im Körper beschleunigen. Im Verdauungsprozess sind sie für den Abbau von Nahrungsmitteln verantwortlich, um sie in eine für den menschlichen Körper aufnehmbare Form zu überführen. Hierbei gibt es verschiedene Arten von Verdauungsenzymen wie die Amylase, Lipasen, Peptidasen oder die Laktase, die im Speichel, dem Magen, der Bauchspeicheldrüse oder dem Darm produziert werden. Im Folgenden werden sie näher beleuchtet. Amylase Die sogenannte Alpha-Amylase wird von den Speicheldrüsen produziert und beginnt somit bereits im Mund mit der Spaltung der (mit der Nahrung aufgenommenen) Kohlenhydrate. Die Pankreasamylase (Pankreas = Bauchspeicheldrüse) setzt, nachdem der Speisebrei im Dünndarm angekommen ist, den Verdauungsprozess der Kohlenhydrate fort. Lipase Lipasen sind für die Fettverdauung von großer Bedeutung. Sie werden von Magen und Pankreas produziert. Im Magen findet die erste Phase der Fettverdauung statt. Im Dünndarm folgt daraufhin die Hauptverdauung der Fette. Peptidasen Für die Proteinverdauung sind sogenannte Peptidasen verantwortlich. Sie werden im Magen, dem Pankreas und den Schleimhautzellen des Dünndarms produziert. Sie spalten Eiweiße in ihre kleinsten Bestandteile auf, damit diese im Darm aufgenommen werden können. Laktase Laktase wird im Dünndarm produziert und spaltet den Milchzucker „Laktose“ in seine Einzelbestandteile „Glukose“ und „Galaktose“. Wird zu wenig Laktase produziert, kann die Laktose nicht aufgespalten werden und gelangt unverdaut in den Dickdarm. Im Dickdarm angekommen, wird sie von den dort ansässigen Darmbakterien verstoffwechselt, wodurch Gase entstehen. Die Folgen können Verdauungsbeschwerden wie Bauchschmerzen oder Flatulenzen (Blähungen) sein. Durch die erhöhte Konzentration von Laktose im Dickdarm kann es zudem zu einem erhöhten Wassereinstrom in den Dickdarm kommen, wodurch Diarrhoe entstehen kann. Fazit Verdauungsenzyme nehmen eine entscheidende Rolle bei der Verdauung von Nahrungsmitteln ein. Ein Mangel dieser Enzyme, durch beispielsweise verschiedene Erkrankungen oder einer Medikamenteneinnahme kann zu schwerwiegenden Folgen in der Verdauung führen.
Enzyme für die Verdauung
Was sind Verdauungsenzyme Enzyme sind Proteine, die chemische Reaktionen im Körper beschleunigen. Im Verdauungsprozess sind sie für den Abbau von Nahrungsmitteln verantwortlich, um sie in eine für den menschlichen Körper aufnehmbare Form zu überführen. Hierbei gibt es verschiedene Arten von Verdauungsenzymen wie die Amylase, Lipasen, Peptidasen oder die Laktase, die im Speichel, dem Magen, der Bauchspeicheldrüse oder dem Darm produziert werden. Im Folgenden werden sie näher beleuchtet. Amylase Die sogenannte Alpha-Amylase wird von den Speicheldrüsen produziert und beginnt somit bereits im Mund mit der Spaltung der (mit der Nahrung aufgenommenen) Kohlenhydrate. Die Pankreasamylase (Pankreas = Bauchspeicheldrüse) setzt, nachdem der Speisebrei im Dünndarm angekommen ist, den Verdauungsprozess der Kohlenhydrate fort. Lipase Lipasen sind für die Fettverdauung von großer Bedeutung. Sie werden von Magen und Pankreas produziert. Im Magen findet die erste Phase der Fettverdauung statt. Im Dünndarm folgt daraufhin die Hauptverdauung der Fette. Peptidasen Für die Proteinverdauung sind sogenannte Peptidasen verantwortlich. Sie werden im Magen, dem Pankreas und den Schleimhautzellen des Dünndarms produziert. Sie spalten Eiweiße in ihre kleinsten Bestandteile auf, damit diese im Darm aufgenommen werden können. Laktase Laktase wird im Dünndarm produziert und spaltet den Milchzucker „Laktose“ in seine Einzelbestandteile „Glukose“ und „Galaktose“. Wird zu wenig Laktase produziert, kann die Laktose nicht aufgespalten werden und gelangt unverdaut in den Dickdarm. Im Dickdarm angekommen, wird sie von den dort ansässigen Darmbakterien verstoffwechselt, wodurch Gase entstehen. Die Folgen können Verdauungsbeschwerden wie Bauchschmerzen oder Flatulenzen (Blähungen) sein. Durch die erhöhte Konzentration von Laktose im Dickdarm kann es zudem zu einem erhöhten Wassereinstrom in den Dickdarm kommen, wodurch Diarrhoe entstehen kann. Fazit Verdauungsenzyme nehmen eine entscheidende Rolle bei der Verdauung von Nahrungsmitteln ein. Ein Mangel dieser Enzyme, durch beispielsweise verschiedene Erkrankungen oder einer Medikamenteneinnahme kann zu schwerwiegenden Folgen in der Verdauung führen.

Nährstoffe für ein gesundes Herz
Bluthochdruck und Herzgesundheit Fast jeder dritte Erwachsene in Deutschland leidet unter einem diagnostizierten Bluthochdruck. Bluthochdruck gehört zu den wichtigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und kann zu verschiedenen Folgeschäden wie Herzinsuffizienz, Herzinfarkt, Schlaganfall, Niereninsuffizienz und -versagen führen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen stellen seit Jahrzehnten eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland dar. Magnesium Der Mineralstoff Magnesium erfüllt im menschlichen Körper vielfältige Aufgaben. Eine ausreichende Versorgung ist nicht nur für die Muskelfunktion, die Knochenstruktur und für die Funktion des Nervensystems entscheidend, sondern auch für die Herzfunktion, indem es unter anderem den Herzrhythmus reguliert. Darüber hinaus dient es als Regulator des Blutdrucks. Magnesium ist in Lebensmitteln wie z.B. Vollkorngetreide, grünes Blattgemüse, Nüssen und Hülsenfrüchte enthalten. Durch den westlichen Lebensstil, welcher einen hohen Konsum an industriell verarbeiteten Lebensmitteln beinhaltet und oftmals mit erhöhtem chronischen Stress einhergeht, kann eine reduzierte Magnesiumversorgung resultieren. Ein Mangel an Magnesium wird mit einem erhöhten Risiko für Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht. Kalium Kalium stellt den Gegenspieler von Natrium dar. Natrium ist Bestandteil von Salz und kann bei übermäßigem Konsum zur Erhöhung des Blutdrucks führen. Kalium hingegen hilft den Blutdruck zu stabilisieren, indem es unter anderem den Wasserhaushalt reguliert und die Wirkung von Natrium „neutralisiert“. Durch die Senkung des Blutdrucks kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfall verringert werden. Zu den kaliumreichen Lebensmitteln zählen beispielsweise Gemüse und Obst wie Bananen, Aprikosen, Avocado, Karotten, Tomaten, sowie Nüsse. Marine Omega-3-Fettsäuren Die marinen Omega-3-Fettsäuren Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA) sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die eine wichtige Rolle in der Herzgesundheit spielen. Sie wirken entzündungsregulierend und tragen zu einer normalen Herzfunktion und zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks und normalen Spiegel der Blutfette (Triglyceride, Cholesterin) bei. EPA und DHA sind in fetten Meeresfischen wie Hering, Lachs, Makrele, in Fisch- und Algenöl zu finden. Um eine gute Versorgung mit EPA und DHA sicherzustellen, sollte der Omega-3-Index im Optimalfall zwischen 8-11 % liegen.
Nährstoffe für ein gesundes Herz
Bluthochdruck und Herzgesundheit Fast jeder dritte Erwachsene in Deutschland leidet unter einem diagnostizierten Bluthochdruck. Bluthochdruck gehört zu den wichtigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und kann zu verschiedenen Folgeschäden wie Herzinsuffizienz, Herzinfarkt, Schlaganfall, Niereninsuffizienz und -versagen führen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen stellen seit Jahrzehnten eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland dar. Magnesium Der Mineralstoff Magnesium erfüllt im menschlichen Körper vielfältige Aufgaben. Eine ausreichende Versorgung ist nicht nur für die Muskelfunktion, die Knochenstruktur und für die Funktion des Nervensystems entscheidend, sondern auch für die Herzfunktion, indem es unter anderem den Herzrhythmus reguliert. Darüber hinaus dient es als Regulator des Blutdrucks. Magnesium ist in Lebensmitteln wie z.B. Vollkorngetreide, grünes Blattgemüse, Nüssen und Hülsenfrüchte enthalten. Durch den westlichen Lebensstil, welcher einen hohen Konsum an industriell verarbeiteten Lebensmitteln beinhaltet und oftmals mit erhöhtem chronischen Stress einhergeht, kann eine reduzierte Magnesiumversorgung resultieren. Ein Mangel an Magnesium wird mit einem erhöhten Risiko für Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht. Kalium Kalium stellt den Gegenspieler von Natrium dar. Natrium ist Bestandteil von Salz und kann bei übermäßigem Konsum zur Erhöhung des Blutdrucks führen. Kalium hingegen hilft den Blutdruck zu stabilisieren, indem es unter anderem den Wasserhaushalt reguliert und die Wirkung von Natrium „neutralisiert“. Durch die Senkung des Blutdrucks kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfall verringert werden. Zu den kaliumreichen Lebensmitteln zählen beispielsweise Gemüse und Obst wie Bananen, Aprikosen, Avocado, Karotten, Tomaten, sowie Nüsse. Marine Omega-3-Fettsäuren Die marinen Omega-3-Fettsäuren Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA) sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die eine wichtige Rolle in der Herzgesundheit spielen. Sie wirken entzündungsregulierend und tragen zu einer normalen Herzfunktion und zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks und normalen Spiegel der Blutfette (Triglyceride, Cholesterin) bei. EPA und DHA sind in fetten Meeresfischen wie Hering, Lachs, Makrele, in Fisch- und Algenöl zu finden. Um eine gute Versorgung mit EPA und DHA sicherzustellen, sollte der Omega-3-Index im Optimalfall zwischen 8-11 % liegen.
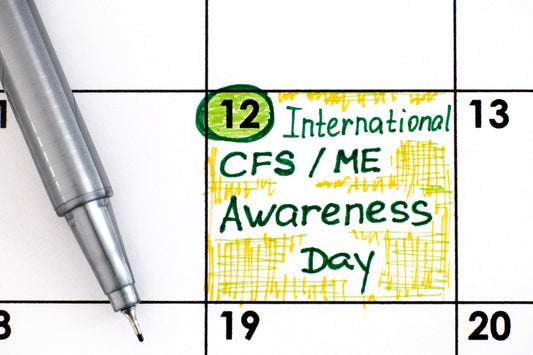
ME / CFS
Wenn aufgrund von chronisch anhaltender extremer/rascher Erschöpfung plötzlich nichts mehr so ist, wie es einmal war, wird häufig von einer „Myalgischen Enzephalomyelitis" (ME) und „chronischem Erschöpfungssyndrom“ (CFS) gesprochen. Die geschätzte Prävalenz beträgt 0,3 % der Bevölkerung. In Deutschland sind es knapp 250.000 Menschen. ME/CFS ist somit keine seltene Erkrankung. Vor allem innerhalb der letzten Jahre hat das Interesse an ME/CFS zugenommen, da es erhebliche Überschneidungen mit dem Post-Covid/Post-Vac-Syndrom gibt. Was wird unter dem Erkrankungsbild ME / CFS verstanden? ME/CFS ist eine schwere neuroimmunologische Erkrankung, die häufig zu starken körperlichen und kognitiven Einschränkungen und einer niedrigen Lebensqualität führt. Die Erkrankung kommt in der Regel mit stillen Entzündungsreaktionen („silent inflammation“) im Körper einher. Sie kann in vier Schweregrade eingestuft werden, in denen die Erkrankten sich entweder selbstständig versorgen können oder aber so schwer betroffen sind, dass sie auf Pflege angewiesen oder gar bettlägerig sind. Gibt es Risikogruppen? Die Erkrankung scheint zwei Altersgipfel des Erkrankungsbeginns aufzuweisen. Vor allem 10-20-Jährige und Menschen zwischen 30-40 Jahren sind hiervon betroffen. Frauen sind dreimal so häufig betroffen wie Männer. Welche Ursachen werden diskutiert? Störungen im Gefäßsystem, des autonomen Nervensystems, des Immunsystems sowie des Energiestoffwechsels führen zu den vielfältigen Symptomen der Erkrankung. ME/CFS tritt gehäuft nach Infektionen wie dem Epstein-Barr-Virus, Influenza, Enteroviren, einer Borrelien- oder SARS-CoV-2-Infektion auf. Welche Symptome können auftreten? Die Kernsymptome sind vielfältig und können verschiedene Körpersysteme wie beispielsweise Folgende betreffen: Post-Exertional Malaise (unverhältnismäßig starke Zustandsverschlechterung nach Belastung) Fatigue (extreme Form der Erschöpfung) Schlafstörungen Schmerzen (Gelenk-, Muskel-, Kopfschmerzen) Autonome/orthostatische Symptome (Schwindel bei Lagewechsel, Herzrasen, Darmstörung, Atemnot bei leichter Belastung) Neurologische/kognitive Symptome (Brain Fog / „Gehirnnebel“, Wortfindungs-, Konzentrations-, Sinnes-, Koordinationsstörungen, Muskelzuckungen) Neuroendokrine Symptome (Schwitzen, fiebriges Gefühl, kalte Hände und/oder Füße) Immunologische Symptome (schmerzhafte Lymphknoten, wiederkehrende Halsschmerzen, grippeähnliche Symptome, Unverträglichkeit von Nahrungsmitteln) Wie wird ME/CFS therapiert? Aufgrund der vielfältigen Auswirkungen auf verschiedene Organsysteme, gibt es zum derzeitigen Zeitpunkt keine spezifischen Medikamente oder Therapien, die bei ME/CFS eingesetzt werden können bzw. zugelassen sind. Die Therapie richtet sich stark nach den jeweiligen Symptomen. In der Regel wird mit verschiedensten Mikronährstoff- oder Vitalpilz-Therapien, dem Einsatz von Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Therapie (Höhentraining), Physiotherapie, Techniken zur Regulation des Nervensystems, einer anti entzündlichen Ernährung und falls möglich Ausdauer- und Krafttraining gearbeitet.
ME / CFS
Wenn aufgrund von chronisch anhaltender extremer/rascher Erschöpfung plötzlich nichts mehr so ist, wie es einmal war, wird häufig von einer „Myalgischen Enzephalomyelitis" (ME) und „chronischem Erschöpfungssyndrom“ (CFS) gesprochen. Die geschätzte Prävalenz beträgt 0,3 % der Bevölkerung. In Deutschland sind es knapp 250.000 Menschen. ME/CFS ist somit keine seltene Erkrankung. Vor allem innerhalb der letzten Jahre hat das Interesse an ME/CFS zugenommen, da es erhebliche Überschneidungen mit dem Post-Covid/Post-Vac-Syndrom gibt. Was wird unter dem Erkrankungsbild ME / CFS verstanden? ME/CFS ist eine schwere neuroimmunologische Erkrankung, die häufig zu starken körperlichen und kognitiven Einschränkungen und einer niedrigen Lebensqualität führt. Die Erkrankung kommt in der Regel mit stillen Entzündungsreaktionen („silent inflammation“) im Körper einher. Sie kann in vier Schweregrade eingestuft werden, in denen die Erkrankten sich entweder selbstständig versorgen können oder aber so schwer betroffen sind, dass sie auf Pflege angewiesen oder gar bettlägerig sind. Gibt es Risikogruppen? Die Erkrankung scheint zwei Altersgipfel des Erkrankungsbeginns aufzuweisen. Vor allem 10-20-Jährige und Menschen zwischen 30-40 Jahren sind hiervon betroffen. Frauen sind dreimal so häufig betroffen wie Männer. Welche Ursachen werden diskutiert? Störungen im Gefäßsystem, des autonomen Nervensystems, des Immunsystems sowie des Energiestoffwechsels führen zu den vielfältigen Symptomen der Erkrankung. ME/CFS tritt gehäuft nach Infektionen wie dem Epstein-Barr-Virus, Influenza, Enteroviren, einer Borrelien- oder SARS-CoV-2-Infektion auf. Welche Symptome können auftreten? Die Kernsymptome sind vielfältig und können verschiedene Körpersysteme wie beispielsweise Folgende betreffen: Post-Exertional Malaise (unverhältnismäßig starke Zustandsverschlechterung nach Belastung) Fatigue (extreme Form der Erschöpfung) Schlafstörungen Schmerzen (Gelenk-, Muskel-, Kopfschmerzen) Autonome/orthostatische Symptome (Schwindel bei Lagewechsel, Herzrasen, Darmstörung, Atemnot bei leichter Belastung) Neurologische/kognitive Symptome (Brain Fog / „Gehirnnebel“, Wortfindungs-, Konzentrations-, Sinnes-, Koordinationsstörungen, Muskelzuckungen) Neuroendokrine Symptome (Schwitzen, fiebriges Gefühl, kalte Hände und/oder Füße) Immunologische Symptome (schmerzhafte Lymphknoten, wiederkehrende Halsschmerzen, grippeähnliche Symptome, Unverträglichkeit von Nahrungsmitteln) Wie wird ME/CFS therapiert? Aufgrund der vielfältigen Auswirkungen auf verschiedene Organsysteme, gibt es zum derzeitigen Zeitpunkt keine spezifischen Medikamente oder Therapien, die bei ME/CFS eingesetzt werden können bzw. zugelassen sind. Die Therapie richtet sich stark nach den jeweiligen Symptomen. In der Regel wird mit verschiedensten Mikronährstoff- oder Vitalpilz-Therapien, dem Einsatz von Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Therapie (Höhentraining), Physiotherapie, Techniken zur Regulation des Nervensystems, einer anti entzündlichen Ernährung und falls möglich Ausdauer- und Krafttraining gearbeitet.

Zu viel vs. zu wenig Magensäure
Probleme durch ein Ungleichgewicht der Magensäure Während eine ausreichende Magensäureproduktion für eine gesunde Verdauung von entscheidender Bedeutung ist, kann sowohl ein Überschuss als auch ein Mangel an Magensäure die Verdauung beeinträchtigen und zu gesundheitlichen Problemen führen. Zu viel Magensäure Die Folge einer erhöhten Magensäureproduktion kann das Aufsteigen von Magensäure in die Speiseröhre sein, was zu Sodbrennen oder einer Refluxkrankheit führt. Die Magensäure reizt die empfindliche Schleimhaut der Speiseröhre und verursacht Schmerzen, Entzündungen und langfristig sogar Schäden an der Speiseröhre. Ein Überschuss an Magensäure kann zudem die Magenschleimhaut schädigen und zu einer Gastritis, das bedeutet eine Entzündung der Magenschleimhaut. In schweren Fällen können Magengeschwüre entstehen. Magensäuremangel Ein Magensäuremangel tritt häufiger auf, als viele denken. Eine westliche Ernährung, die mit dem Konsum von reichlich hoch verarbeiteten Fertigprodukten einhergeht, kann ursächlich hierfür sein. Wenn die Magensäureproduktion zu niedrig ist, wird der Verdauungsprozess erheblich gestört. Der Mangel an Magensäure schwächt die Fähigkeit des Körpers, Bakterien und Krankheitserreger zu bekämpfen. Dies kann das Risiko für Lebensmittelvergiftungen und Magen-Darm-Infektionen erhöhen. Menschen mit Magensäuremangel sind zudem anfälliger für eine Dünndarmfehlbesiedelung (SIBO), die mit Blähungen, Durchfall und Bauchschmerzen einhergehen kann. Ohne genügend Magensäure können Proteine aus der Nahrung nicht richtig verdaut werden. Dies kann nicht nur zu einer unzureichenden Nährstoffaufnahme führen, sondern auch zu Blähungen, Völlegefühl und Übelkeit nach den Mahlzeiten. Ein niedriger pH-Wert im Magen ist zudem für die Aufnahme bestimmter Nährstoffe entscheidend. Ein Mangel an Magensäure kann die Aufnahme von Eisen, Calcium und Vitamin B12 behindern, was langfristig zu Mangelerscheinungen führen kann. Insbesondere Eisenmangel und Vitamin B12-Mangel sind häufige Ursachen für Blutarmut und Müdigkeit. Fazit: Die Magensäure ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Verdauungsprozesses, der eine effektive Verdauung von Nahrungsmitteln ermöglicht, den Körper vor Infektionen schützt und sicherstellt, dass wichtige Nährstoffe aus der Nahrung aufgenommen werden können. Ein Mangel an Magensäure kann die Verdauung erheblich stören, während ein Überschuss an Magensäure zu Refluxkrankheit und Magenbeschwerden führen kann. Eine ausgewogene Produktion von Magensäure ist daher entscheidend für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Verdauungssystems.
Zu viel vs. zu wenig Magensäure
Probleme durch ein Ungleichgewicht der Magensäure Während eine ausreichende Magensäureproduktion für eine gesunde Verdauung von entscheidender Bedeutung ist, kann sowohl ein Überschuss als auch ein Mangel an Magensäure die Verdauung beeinträchtigen und zu gesundheitlichen Problemen führen. Zu viel Magensäure Die Folge einer erhöhten Magensäureproduktion kann das Aufsteigen von Magensäure in die Speiseröhre sein, was zu Sodbrennen oder einer Refluxkrankheit führt. Die Magensäure reizt die empfindliche Schleimhaut der Speiseröhre und verursacht Schmerzen, Entzündungen und langfristig sogar Schäden an der Speiseröhre. Ein Überschuss an Magensäure kann zudem die Magenschleimhaut schädigen und zu einer Gastritis, das bedeutet eine Entzündung der Magenschleimhaut. In schweren Fällen können Magengeschwüre entstehen. Magensäuremangel Ein Magensäuremangel tritt häufiger auf, als viele denken. Eine westliche Ernährung, die mit dem Konsum von reichlich hoch verarbeiteten Fertigprodukten einhergeht, kann ursächlich hierfür sein. Wenn die Magensäureproduktion zu niedrig ist, wird der Verdauungsprozess erheblich gestört. Der Mangel an Magensäure schwächt die Fähigkeit des Körpers, Bakterien und Krankheitserreger zu bekämpfen. Dies kann das Risiko für Lebensmittelvergiftungen und Magen-Darm-Infektionen erhöhen. Menschen mit Magensäuremangel sind zudem anfälliger für eine Dünndarmfehlbesiedelung (SIBO), die mit Blähungen, Durchfall und Bauchschmerzen einhergehen kann. Ohne genügend Magensäure können Proteine aus der Nahrung nicht richtig verdaut werden. Dies kann nicht nur zu einer unzureichenden Nährstoffaufnahme führen, sondern auch zu Blähungen, Völlegefühl und Übelkeit nach den Mahlzeiten. Ein niedriger pH-Wert im Magen ist zudem für die Aufnahme bestimmter Nährstoffe entscheidend. Ein Mangel an Magensäure kann die Aufnahme von Eisen, Calcium und Vitamin B12 behindern, was langfristig zu Mangelerscheinungen führen kann. Insbesondere Eisenmangel und Vitamin B12-Mangel sind häufige Ursachen für Blutarmut und Müdigkeit. Fazit: Die Magensäure ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Verdauungsprozesses, der eine effektive Verdauung von Nahrungsmitteln ermöglicht, den Körper vor Infektionen schützt und sicherstellt, dass wichtige Nährstoffe aus der Nahrung aufgenommen werden können. Ein Mangel an Magensäure kann die Verdauung erheblich stören, während ein Überschuss an Magensäure zu Refluxkrankheit und Magenbeschwerden führen kann. Eine ausgewogene Produktion von Magensäure ist daher entscheidend für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Verdauungssystems.
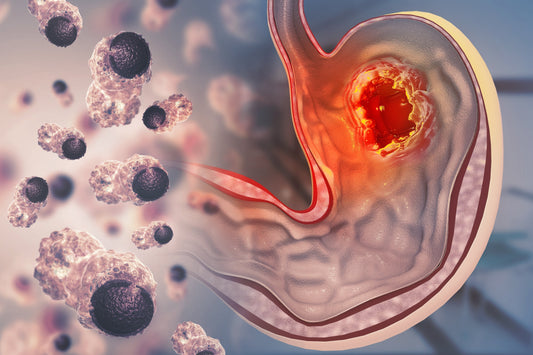
Magensäure
Magensäure und ihre zentrale Rolle in der Verdauung Magensäure ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Verdauungssystems. Sie wird in bestimmten Zellen der Magenschleimhaut produziert und hat mehrere grundlegende Funktionen, ohne die unser Körper nicht in der Lage wäre, die Nahrung effizient zu verarbeiten und lebenswichtige Nährstoffe zu gewinnen. Nährstoffaufnahme Magensäure ist unerlässlich für die Aufnahme bestimmter Nährstoffe wie Eisen, Calcium und Vitamin B12. Eisen aus pflanzlichen Quellen benötigt eine saure Umgebung, um besser vom Körper aufgenommen zu werden. Auch die Aufnahme von Vitamin B12 im Dünndarm ist ohne die Ausschüttung des „Intrinsic Factor“ im sauren Magen nicht möglich. Proteinverdauung Magensäure ist entscheidend für die Proteinverdauung, indem es ein bestimmtes Enzym, das sogenannte Pepsin, aktiviert. Pepsin übernimmt die erste Stufe der Proteinverdauung im Magen. Ohne Pepsin wären die Proteine in der Nahrung zu groß, um im Dünndarm weiter verdaut zu werden, was die Nährstoffaufnahme erheblich beeinträchtigen würde. Pepsin zerlegt Proteine in kleinere Polypeptide, die dann von anderen Enzymen im Dünndarm weiter zerlegt und vom Körper aufgenommen werden können. Bakterienabwehr Der niedrige pH-Wert des Magens sorgt dafür, dass Krankheitserreger, wie etwa Bakterien und Viren, die in vielen Lebensmitteln vorhanden sein können, inaktiviert werden, bevor sie den Dünndarm erreichen. Diese Funktion schützt den Körper vor einer Vielzahl von Infektionen und Erkrankungen, die durch verunreinigte oder verdorbene Nahrungsmittel übertragen werden könnten. Fazit Die Magensäure ist nicht nur für negative Aspekte wie Sodbrennen oder eine Entzündung der Magenschleimhaut verantwortlich, sondern nimmt vor allem hinsichtlich der Verdauung und somit der Nährstoffversorgung und Allgemeingesundheit eine entscheidende Rolle ein.
Magensäure
Magensäure und ihre zentrale Rolle in der Verdauung Magensäure ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Verdauungssystems. Sie wird in bestimmten Zellen der Magenschleimhaut produziert und hat mehrere grundlegende Funktionen, ohne die unser Körper nicht in der Lage wäre, die Nahrung effizient zu verarbeiten und lebenswichtige Nährstoffe zu gewinnen. Nährstoffaufnahme Magensäure ist unerlässlich für die Aufnahme bestimmter Nährstoffe wie Eisen, Calcium und Vitamin B12. Eisen aus pflanzlichen Quellen benötigt eine saure Umgebung, um besser vom Körper aufgenommen zu werden. Auch die Aufnahme von Vitamin B12 im Dünndarm ist ohne die Ausschüttung des „Intrinsic Factor“ im sauren Magen nicht möglich. Proteinverdauung Magensäure ist entscheidend für die Proteinverdauung, indem es ein bestimmtes Enzym, das sogenannte Pepsin, aktiviert. Pepsin übernimmt die erste Stufe der Proteinverdauung im Magen. Ohne Pepsin wären die Proteine in der Nahrung zu groß, um im Dünndarm weiter verdaut zu werden, was die Nährstoffaufnahme erheblich beeinträchtigen würde. Pepsin zerlegt Proteine in kleinere Polypeptide, die dann von anderen Enzymen im Dünndarm weiter zerlegt und vom Körper aufgenommen werden können. Bakterienabwehr Der niedrige pH-Wert des Magens sorgt dafür, dass Krankheitserreger, wie etwa Bakterien und Viren, die in vielen Lebensmitteln vorhanden sein können, inaktiviert werden, bevor sie den Dünndarm erreichen. Diese Funktion schützt den Körper vor einer Vielzahl von Infektionen und Erkrankungen, die durch verunreinigte oder verdorbene Nahrungsmittel übertragen werden könnten. Fazit Die Magensäure ist nicht nur für negative Aspekte wie Sodbrennen oder eine Entzündung der Magenschleimhaut verantwortlich, sondern nimmt vor allem hinsichtlich der Verdauung und somit der Nährstoffversorgung und Allgemeingesundheit eine entscheidende Rolle ein.
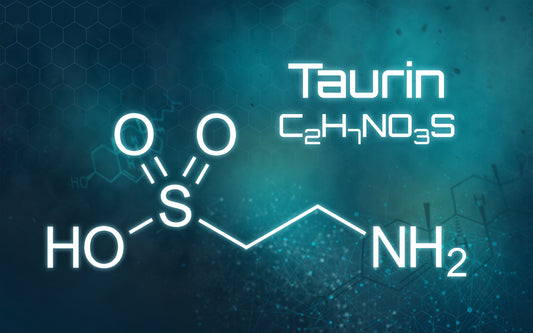
Jungbrunnen Taurin?
Viele suchen es verzweifelt: Das Mittel der ewigen Jugend. Auch die Wissenschaft befasst sich seit Jahrzehnten mit der Frage, welche Substanzen oder Lebensstilfaktoren sich positiv auf die Gesundheit, aber auch die Alterung auswirken können. Festgestellt werden konnte, dass die Taurin-Konzentration im Blut mit der Gesundheit korreliert. Aus diesem Grund befassten sich Forscher mit der Fragestellung, ob die Taurin-Konzentration im Blut auch das Altern beeinflusst. Taurin stellt eine der am häufigsten vorkommenden Aminosäuren im Menschen dar. Abnehmende Taurinspiegel im Alter Die Forscher bestimmten die Blutkonzentration von Taurin während des Alterns, um die Auswirkungen einer Taurin-Ergänzung auf die Gesundheit und Lebensdauer mehrerer Spezies zu untersuchen. Sie konnten herausfinden, dass die Blutkonzentration von Taurin mit zunehmendem Alter sowohl bei Mäusen, Affen als auch beim Menschen abnimmt. Um nun zu untersuchen, ob der Rückgang auch wirklich zum Altern führt, wurden Mäusen mittleren Alters bis zum Lebensende einmal täglich Taurin oder eine Kontrolllösung oral verabreicht. Tierstudien Mäuse (sowohl weiblich als auch männlich), die mit Taurin supplementiert wurden, lebten länger als die Kontroll Mäuse. Daraufhin wurde die Gesundheit der Mäuse untersucht. Es konnte eine verbesserte Funktion von Knochen, Muskeln, Bauchspeicheldrüse, des Gehirns, des Darm, des Fettgewebes und des Immunsystems festgestellt werden, was auf eine allgemeine Verbesserung der Gesundheitspanne hinweist. Bei Affen konnten ähnliche Effekte beobachtet werden. Um zu überprüfen, ob die Wirkungen von Taurin über die Artengrenzen hinausgehen, wurde daraufhin untersucht, ob eine Taurin-Supplementation auch die Lebensdauer von Würmern und Hefen verlängert. Bei Hefen konnte die Lebensdauer nicht beeinflusst werden, bei Würmern hingegen schon. Doch wie schafft es Taurin, mehrere Merkmale des Alterns positiv zu beeinflussen? In Untersuchungen reduzierte Taurin u.a. die Zellalterung, verringerte Schäden an der DNA (Erbgut), schwächte Entzündungen ab und unterdrückte mitochondriale Dysfunktionen (Dysfunktionen in der Energiegewinnung). Niedrige Taurinspiegel Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass eine niedrige Taurin-, Hypotaurin-, und N-Acetyl Taurin-Konzentration mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie z.B. einer erhöhten abdominellen Fettleibigkeit (erhöhtem „Bauchfett“), Bluthochdruck, Entzündungen, Lebererkrankungen und der Prävalenz von Diabetes mellitus Typ 2 verbunden waren. Eine Trainingseinheit erhöhte die Konzentration von Taurin-Metaboliten im Blut, was der Anti-Aging-Wirkung von Training teilweise zugrunde liegen könnte. Wie aussagekräftig sind Tierstudien? Die Frage ist nun: Können die Ergebnisse zu 100 % auf den Menschen übertragen werden? Ich muss dich leider enttäuschen: Nein können sie nicht. Um die Gesundheitsspanne und die Lebensdauer als Ergebnisse zu messen, sind langfristige und gut kontrollierte Studien zur Taurin-Supplementierung erforderlich. Taurinreiche Lebensmittel Taurinreich sind Lebensmittel wie Schalentiere, insbesondere Jakobsmuscheln, Muscheln und Venusmuscheln, oder Leber. Auch Energydrinks enthalten (aufgrund der Zugabe) Taurin. Ist der Konsum von Energydrinks deshalb zu empfehlen? Definitiv nicht. Es sollte sich bei der Beurteilung eines Lebensmittel stets die gesamte Lebensmittelmatrix des Lebensmittels angeschaut werden. Egal wie positiv der Effekt durch Taurin eventuell ist, die negativen Effekte durch den regelmäßigen Konsum von Energydrinks würden stets überwiegen.
Jungbrunnen Taurin?
Viele suchen es verzweifelt: Das Mittel der ewigen Jugend. Auch die Wissenschaft befasst sich seit Jahrzehnten mit der Frage, welche Substanzen oder Lebensstilfaktoren sich positiv auf die Gesundheit, aber auch die Alterung auswirken können. Festgestellt werden konnte, dass die Taurin-Konzentration im Blut mit der Gesundheit korreliert. Aus diesem Grund befassten sich Forscher mit der Fragestellung, ob die Taurin-Konzentration im Blut auch das Altern beeinflusst. Taurin stellt eine der am häufigsten vorkommenden Aminosäuren im Menschen dar. Abnehmende Taurinspiegel im Alter Die Forscher bestimmten die Blutkonzentration von Taurin während des Alterns, um die Auswirkungen einer Taurin-Ergänzung auf die Gesundheit und Lebensdauer mehrerer Spezies zu untersuchen. Sie konnten herausfinden, dass die Blutkonzentration von Taurin mit zunehmendem Alter sowohl bei Mäusen, Affen als auch beim Menschen abnimmt. Um nun zu untersuchen, ob der Rückgang auch wirklich zum Altern führt, wurden Mäusen mittleren Alters bis zum Lebensende einmal täglich Taurin oder eine Kontrolllösung oral verabreicht. Tierstudien Mäuse (sowohl weiblich als auch männlich), die mit Taurin supplementiert wurden, lebten länger als die Kontroll Mäuse. Daraufhin wurde die Gesundheit der Mäuse untersucht. Es konnte eine verbesserte Funktion von Knochen, Muskeln, Bauchspeicheldrüse, des Gehirns, des Darm, des Fettgewebes und des Immunsystems festgestellt werden, was auf eine allgemeine Verbesserung der Gesundheitspanne hinweist. Bei Affen konnten ähnliche Effekte beobachtet werden. Um zu überprüfen, ob die Wirkungen von Taurin über die Artengrenzen hinausgehen, wurde daraufhin untersucht, ob eine Taurin-Supplementation auch die Lebensdauer von Würmern und Hefen verlängert. Bei Hefen konnte die Lebensdauer nicht beeinflusst werden, bei Würmern hingegen schon. Doch wie schafft es Taurin, mehrere Merkmale des Alterns positiv zu beeinflussen? In Untersuchungen reduzierte Taurin u.a. die Zellalterung, verringerte Schäden an der DNA (Erbgut), schwächte Entzündungen ab und unterdrückte mitochondriale Dysfunktionen (Dysfunktionen in der Energiegewinnung). Niedrige Taurinspiegel Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass eine niedrige Taurin-, Hypotaurin-, und N-Acetyl Taurin-Konzentration mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie z.B. einer erhöhten abdominellen Fettleibigkeit (erhöhtem „Bauchfett“), Bluthochdruck, Entzündungen, Lebererkrankungen und der Prävalenz von Diabetes mellitus Typ 2 verbunden waren. Eine Trainingseinheit erhöhte die Konzentration von Taurin-Metaboliten im Blut, was der Anti-Aging-Wirkung von Training teilweise zugrunde liegen könnte. Wie aussagekräftig sind Tierstudien? Die Frage ist nun: Können die Ergebnisse zu 100 % auf den Menschen übertragen werden? Ich muss dich leider enttäuschen: Nein können sie nicht. Um die Gesundheitsspanne und die Lebensdauer als Ergebnisse zu messen, sind langfristige und gut kontrollierte Studien zur Taurin-Supplementierung erforderlich. Taurinreiche Lebensmittel Taurinreich sind Lebensmittel wie Schalentiere, insbesondere Jakobsmuscheln, Muscheln und Venusmuscheln, oder Leber. Auch Energydrinks enthalten (aufgrund der Zugabe) Taurin. Ist der Konsum von Energydrinks deshalb zu empfehlen? Definitiv nicht. Es sollte sich bei der Beurteilung eines Lebensmittel stets die gesamte Lebensmittelmatrix des Lebensmittels angeschaut werden. Egal wie positiv der Effekt durch Taurin eventuell ist, die negativen Effekte durch den regelmäßigen Konsum von Energydrinks würden stets überwiegen.

Cholin
Was ist Cholin? Cholin ist ein wichtiger Nährstoff, der für die Funktion von Leber, Gehirn und Muskeln unerlässlich ist. Der Nährstoff ist Bestandteil jeder einzelnen Zelle unseres Körpers und spielt damit eine wichtige Rolle in zahlreichen Stoffwechselprozessen. Darüber hinaus dient Cholin als Vorläufer von beispielsweise dem Neurotransmitter Acetylcholin. Cholin kann aus der Nahrung aufgenommen werden und zu einem gewissen Teil vom Körper selbst hergestellt werden. Wann steigt der Bedarf an Cholin an? Der Cholin-Bedarf steigt insbesondere während der Schwangerschaft, da Cholin für die Plazentafunktion, die Gehirnentwicklung des Ungeborenen sowie das fetale Wachstum von großer Bedeutung ist. Des Weiteren scheint Cholin sich positiv auf die Augengesundheit von Kindern auswirken zu können. Vor allem die ersten 1.000 Tage von der Empfängnis bis zum Alter von zwei Jahren scheinen hierbei entscheidend zu sein. Neue Erkenntnisse zeigen, dass sich DHA und Cholin in ihrer Wirkung verstärken. Eine unzureichende Zufuhr von einem oder beiden Nährstoffen kann zu lebenslangen schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Mutter und Kind, wie z.B. einem erhöhten Risiko für Verhaltensstörungen, oder einer verminderten geistigen Leistungsfähigkeit führen. Ein Cholinmangel in dieser sensiblen Phase kann zudem zu Frühgeburten sowie schweren Erkrankungen wie beispielsweise Mukoviszidose führen. Wie viel Cholin sollte täglich aufgenommen werden? Der Cholin-Bedarf unterscheidet sich je nach Alter, Geschlecht und den Lebensumständen (Schwangerschaft, Stillzeit). Laut Europäischer Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) liegt eine adäquate tägliche Aufnahme (für gesunde Erwachsene) bei 400 mg Cholin. Schwangere und Stillende sollten täglich 480-520 mg Cholin aufnehmen. Das US-amerikanische Institute of Medicine (IOC) empfiehlt Schwangeren eine tägliche Aufnahme von 450 mg und Stillenden eine tägliche Aufnahme von 550 mg Cholin. In welchen Lebensmitteln ist Cholin enthalten? Cholin ist in großen Mengen vor allem in tierischen Lebensmitteln wie Eiern, Fisch oder Fleisch (vor allem Leber) enthalten. Auch in beispielsweise Weizenkeimen sowie in Sojabohnen ist Cholin in moderaten Mengen enthalten. Wie ist die Versorgungslage gebärfähiger Frauen?! Daten aus der NHANES-Studie (2015-2016) zeigen, dass Frauen im gebärfähigen Alter täglich etwa 287 mg Cholin aufnehmen. Dies liegt deutlich unter den Empfehlungen für schwangere Frauen.
Cholin
Was ist Cholin? Cholin ist ein wichtiger Nährstoff, der für die Funktion von Leber, Gehirn und Muskeln unerlässlich ist. Der Nährstoff ist Bestandteil jeder einzelnen Zelle unseres Körpers und spielt damit eine wichtige Rolle in zahlreichen Stoffwechselprozessen. Darüber hinaus dient Cholin als Vorläufer von beispielsweise dem Neurotransmitter Acetylcholin. Cholin kann aus der Nahrung aufgenommen werden und zu einem gewissen Teil vom Körper selbst hergestellt werden. Wann steigt der Bedarf an Cholin an? Der Cholin-Bedarf steigt insbesondere während der Schwangerschaft, da Cholin für die Plazentafunktion, die Gehirnentwicklung des Ungeborenen sowie das fetale Wachstum von großer Bedeutung ist. Des Weiteren scheint Cholin sich positiv auf die Augengesundheit von Kindern auswirken zu können. Vor allem die ersten 1.000 Tage von der Empfängnis bis zum Alter von zwei Jahren scheinen hierbei entscheidend zu sein. Neue Erkenntnisse zeigen, dass sich DHA und Cholin in ihrer Wirkung verstärken. Eine unzureichende Zufuhr von einem oder beiden Nährstoffen kann zu lebenslangen schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Mutter und Kind, wie z.B. einem erhöhten Risiko für Verhaltensstörungen, oder einer verminderten geistigen Leistungsfähigkeit führen. Ein Cholinmangel in dieser sensiblen Phase kann zudem zu Frühgeburten sowie schweren Erkrankungen wie beispielsweise Mukoviszidose führen. Wie viel Cholin sollte täglich aufgenommen werden? Der Cholin-Bedarf unterscheidet sich je nach Alter, Geschlecht und den Lebensumständen (Schwangerschaft, Stillzeit). Laut Europäischer Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) liegt eine adäquate tägliche Aufnahme (für gesunde Erwachsene) bei 400 mg Cholin. Schwangere und Stillende sollten täglich 480-520 mg Cholin aufnehmen. Das US-amerikanische Institute of Medicine (IOC) empfiehlt Schwangeren eine tägliche Aufnahme von 450 mg und Stillenden eine tägliche Aufnahme von 550 mg Cholin. In welchen Lebensmitteln ist Cholin enthalten? Cholin ist in großen Mengen vor allem in tierischen Lebensmitteln wie Eiern, Fisch oder Fleisch (vor allem Leber) enthalten. Auch in beispielsweise Weizenkeimen sowie in Sojabohnen ist Cholin in moderaten Mengen enthalten. Wie ist die Versorgungslage gebärfähiger Frauen?! Daten aus der NHANES-Studie (2015-2016) zeigen, dass Frauen im gebärfähigen Alter täglich etwa 287 mg Cholin aufnehmen. Dies liegt deutlich unter den Empfehlungen für schwangere Frauen.

DASH-Diät – Ernährung bei Bluthochdruck
Bluthochdruck gehört zu den wichtigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, indem er die Gefäße schädigt und somit das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall oder Nierenschäden erhöhen kann. Das Problem: Bluthochdruck wird oftmals auf Grund von fehlenden Beschwerden nicht spürbar wahrgenommen, weswegen er jahrelang unentdeckt bleiben kann. Ab wann gilt der Blutdruck als erhöht? Der Grenzwert für Bluthochdruck liegt bei 140/90 mmHg. Oberhalb dieses Grenzwertes ist eine Behandlung zu empfehlen. Unterhalb des Grenzwertes gilt der Blutdruck jedoch nicht als ungefährlich. Ein Blutdruck von unter 120/80 mmHg gilt als optimal. Der Blutdruck sollte im Optimalfall regelmäßig zuhause getestet werden, um Einflussfaktoren wie Nervosität beim Arzt und daraus folgend erhöhte Blutdruckwerte auszuschließen. Risikofaktoren für einen erhöhten Blutdruck In Deutschland leidet Schätzungen zufolge jeder dritte Erwachsene unter Bluthochdruck. Risikofaktoren sind ungünstige Ernährungs- und Lebensbedingungen wie Übergewicht, ein hoher Kochsalz- und Alkoholkonsum, Bewegungsmangel und Stress. DASH-Diät Die „Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH)“-Diät stellt eine Diät zur Reduktion des Bluthochdrucks dar. Primär soll das Ernährungsverhalten verändert und auf diese Weise der Blutdruck gesenkt werden. Durch die Begrenzung der Salzzufuhr (höchstens 6 g Salz = ca. 1 Teelöffel am Tag) kann bei Patienten, die sensibel auf Salz reagieren, der Blutdruck gesenkt werden. Salz kann beispielsweise durch Kräuter ersetzt werden. Zudem wirkt sich eine erhöhte Zufuhr von Kalium, Magnesium, Calcium und Ballaststoffen positiv auf den Blutdruck aus. Es wird empfohlen, reichlich Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst und Vollkornprodukte zu verzehren. Weiterhin wird der Konsum von Fisch, Geflügel, fettarmen Milchprodukten und Nüssen empfohlen. Lebensmittel wie Weißmehlprodukte, Süßigkeiten, Alkohol sowie Wurst werden hingegen nicht empfohlen. Kann die DASH-Diät dauerhaft durchgeführt werden?! Die DASH-Diät stellt eine ausgewogene Nährstoffversorgung sicher und kann laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) dauerhaft angewendet werden. Besonders für salzsensitive und übergewichtige Personen mit einem erhöhten Blutdruck eignet sich die DASH-Diät zur Senkung des Blutdrucks.
DASH-Diät – Ernährung bei Bluthochdruck
Bluthochdruck gehört zu den wichtigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, indem er die Gefäße schädigt und somit das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall oder Nierenschäden erhöhen kann. Das Problem: Bluthochdruck wird oftmals auf Grund von fehlenden Beschwerden nicht spürbar wahrgenommen, weswegen er jahrelang unentdeckt bleiben kann. Ab wann gilt der Blutdruck als erhöht? Der Grenzwert für Bluthochdruck liegt bei 140/90 mmHg. Oberhalb dieses Grenzwertes ist eine Behandlung zu empfehlen. Unterhalb des Grenzwertes gilt der Blutdruck jedoch nicht als ungefährlich. Ein Blutdruck von unter 120/80 mmHg gilt als optimal. Der Blutdruck sollte im Optimalfall regelmäßig zuhause getestet werden, um Einflussfaktoren wie Nervosität beim Arzt und daraus folgend erhöhte Blutdruckwerte auszuschließen. Risikofaktoren für einen erhöhten Blutdruck In Deutschland leidet Schätzungen zufolge jeder dritte Erwachsene unter Bluthochdruck. Risikofaktoren sind ungünstige Ernährungs- und Lebensbedingungen wie Übergewicht, ein hoher Kochsalz- und Alkoholkonsum, Bewegungsmangel und Stress. DASH-Diät Die „Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH)“-Diät stellt eine Diät zur Reduktion des Bluthochdrucks dar. Primär soll das Ernährungsverhalten verändert und auf diese Weise der Blutdruck gesenkt werden. Durch die Begrenzung der Salzzufuhr (höchstens 6 g Salz = ca. 1 Teelöffel am Tag) kann bei Patienten, die sensibel auf Salz reagieren, der Blutdruck gesenkt werden. Salz kann beispielsweise durch Kräuter ersetzt werden. Zudem wirkt sich eine erhöhte Zufuhr von Kalium, Magnesium, Calcium und Ballaststoffen positiv auf den Blutdruck aus. Es wird empfohlen, reichlich Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst und Vollkornprodukte zu verzehren. Weiterhin wird der Konsum von Fisch, Geflügel, fettarmen Milchprodukten und Nüssen empfohlen. Lebensmittel wie Weißmehlprodukte, Süßigkeiten, Alkohol sowie Wurst werden hingegen nicht empfohlen. Kann die DASH-Diät dauerhaft durchgeführt werden?! Die DASH-Diät stellt eine ausgewogene Nährstoffversorgung sicher und kann laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) dauerhaft angewendet werden. Besonders für salzsensitive und übergewichtige Personen mit einem erhöhten Blutdruck eignet sich die DASH-Diät zur Senkung des Blutdrucks.

Insekten in der Ernährung?!
Weltweit gibt es mehr als 1.900 essbare Insektenarten. In vielen Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas sind Insekten seit Jahrtausenden ein wichtiger Bestandteil der menschlichen Ernährung. In der EU werden sie zu den sogenannten „Novel Foods“ gezählt. Welche Insekten werden am häufigsten verzehrt? Neben Käfern werden vor allem Schmetterlinge / Raupen, Ameisen, Wespen, Bienen, Larven und Puppen (je nach Insektenart) als Lebensmittel genutzt. Welche Insekten sind in der EU zugelassen? In der EU wurden bisher vier Insekten als Lebensmittel zugelassen. Dazu zählen: Mehlkäfer (im Larvenstadium getrocknet) Wanderheuschrecke (gefroren, getrocknet, pulverförmig) Hausgrille (gefroren, getrocknet, pulverförmig / teilweise entfettetes Pulver) Buffalowurm / Getreideschimmelkäfer (gefroren, pastenartig, getrocknet, pulverisiert) Vorteile von Insekten in der Ernährung Insekten stellen gute Nährstofflieferanten dar. Sie enthalten hochwertiges Eiweiß, Fett mit einem hohen Anteil gesundheitsförderlicher ungesättigter Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe wie z.B. Kupfer, Eisen, Magnesium, Mangan, Selen und Zink. Die Gehalte variieren je nach Insekt und Futterzusammensetzung stark. Insekten können einen Beitrag als wertvolles Nahrungsmittel zur Ernährungssicherung weltweit leisten, da sie eine hohe Futterverwertung Effizienz aufweisen. Rinder benötigen, um 1 kg Biomasse aufzubauen, ca. 8 kg Futter, Schweine benötigen ca. 5 kg Futter, Insekten hingegen durchschnittlich nur ca. 2 kg Futter. Zudem benötigen Sie in der Aufzucht weniger Platz und Wasser. Mögliche Probleme von Insekten in der Ernährung Insekten gelten (vor allem im rohen Zustand) als Überträger von Krankheitserregern wie Salmonellen oder E. coliBakterien. In Abhängigkeit des Ursprungslandes und der hygienischen Gegebenheiten bei der Bearbeitung (unter anderem der Trocknung) können hohe Gehalte an Mykotoxinen auftreten. Auch Parasiten können zur Kontamination beitragen. Aus diesem Grund sollten die Produkte vor dem Verzehr entsprechend erhitzt werden. Bei bereits gegarten Produkten sollte auf eine ausreichende Kühlung geachtet werden. Aufgrund des Proteingehaltes kann der Verzehr von Insekten zudem zu allergischen Reaktionen führen.
Insekten in der Ernährung?!
Weltweit gibt es mehr als 1.900 essbare Insektenarten. In vielen Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas sind Insekten seit Jahrtausenden ein wichtiger Bestandteil der menschlichen Ernährung. In der EU werden sie zu den sogenannten „Novel Foods“ gezählt. Welche Insekten werden am häufigsten verzehrt? Neben Käfern werden vor allem Schmetterlinge / Raupen, Ameisen, Wespen, Bienen, Larven und Puppen (je nach Insektenart) als Lebensmittel genutzt. Welche Insekten sind in der EU zugelassen? In der EU wurden bisher vier Insekten als Lebensmittel zugelassen. Dazu zählen: Mehlkäfer (im Larvenstadium getrocknet) Wanderheuschrecke (gefroren, getrocknet, pulverförmig) Hausgrille (gefroren, getrocknet, pulverförmig / teilweise entfettetes Pulver) Buffalowurm / Getreideschimmelkäfer (gefroren, pastenartig, getrocknet, pulverisiert) Vorteile von Insekten in der Ernährung Insekten stellen gute Nährstofflieferanten dar. Sie enthalten hochwertiges Eiweiß, Fett mit einem hohen Anteil gesundheitsförderlicher ungesättigter Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe wie z.B. Kupfer, Eisen, Magnesium, Mangan, Selen und Zink. Die Gehalte variieren je nach Insekt und Futterzusammensetzung stark. Insekten können einen Beitrag als wertvolles Nahrungsmittel zur Ernährungssicherung weltweit leisten, da sie eine hohe Futterverwertung Effizienz aufweisen. Rinder benötigen, um 1 kg Biomasse aufzubauen, ca. 8 kg Futter, Schweine benötigen ca. 5 kg Futter, Insekten hingegen durchschnittlich nur ca. 2 kg Futter. Zudem benötigen Sie in der Aufzucht weniger Platz und Wasser. Mögliche Probleme von Insekten in der Ernährung Insekten gelten (vor allem im rohen Zustand) als Überträger von Krankheitserregern wie Salmonellen oder E. coliBakterien. In Abhängigkeit des Ursprungslandes und der hygienischen Gegebenheiten bei der Bearbeitung (unter anderem der Trocknung) können hohe Gehalte an Mykotoxinen auftreten. Auch Parasiten können zur Kontamination beitragen. Aus diesem Grund sollten die Produkte vor dem Verzehr entsprechend erhitzt werden. Bei bereits gegarten Produkten sollte auf eine ausreichende Kühlung geachtet werden. Aufgrund des Proteingehaltes kann der Verzehr von Insekten zudem zu allergischen Reaktionen führen.

Novel Foods
Lebensmittel können im Rahmen der lebensmittelrechtlichen Bestimmungen ohne vorherige Zulassung in den Verkehr gebracht werden. Sogenannte „Novel Foods“ nehmen hierbei jedoch eine Sonderstellung ein. Novel Foods - Neuartige Lebensmittel Zu den „neuartigen Lebensmitteln“ zählen laut Novel Food-Verordnung (EU) 2015/2283 alle Lebensmittel, die vor dem 15.05.1997 nicht in nennenswertem Umfang in der Union für den menschlichen Verzehr verwendet wurden und beispielsweise aus Mikroorganismen, Pilzen, Algen, Tieren oder deren Teilen, Pflanzen oder Pflanzenteilen bestehen oder daraus isoliert oder erzeugt oder durch neuartige, nicht übliche Verfahren hergestellt wurden. Welche Lebensmittel zählen zu den Novel Foods? Zu den Novel Foods zählen Lebensmittel wie: Chiasamen Essbare Insekten Spezielle Algenarten Durch Nanotechnik hergestelltes Klonfleisch Baobab-Früchte Wasserkastanien Krill-Öl Früchte des Noni-Baums Produkte mit cholesterinsenkenden Zusätzen Traditionelle Lebensmittel Traditionelle Lebensmittel sind eine Untergruppe der neuartigen Lebensmittel und beziehen sich auf Lebensmittel, die traditionell in Ländern außerhalb Europas seit mindestens 25 Jahren konsumiert werden und als sicher gelten. Wer ist für die Zulassung zuständig? Das Zulassungsverfahren wird von der Europäischen Kommission und der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) durchgeführt. Lebensmittelhersteller müssen, falls sie ein neuartiges Lebensmittel in Verkehr bringen möchten, welches sich noch nicht in der Unionsliste zugelassener neuartiger Lebensmittel befindet, einen Zulassungsantrag bei der Europäischen Kommission stellen.
Novel Foods
Lebensmittel können im Rahmen der lebensmittelrechtlichen Bestimmungen ohne vorherige Zulassung in den Verkehr gebracht werden. Sogenannte „Novel Foods“ nehmen hierbei jedoch eine Sonderstellung ein. Novel Foods - Neuartige Lebensmittel Zu den „neuartigen Lebensmitteln“ zählen laut Novel Food-Verordnung (EU) 2015/2283 alle Lebensmittel, die vor dem 15.05.1997 nicht in nennenswertem Umfang in der Union für den menschlichen Verzehr verwendet wurden und beispielsweise aus Mikroorganismen, Pilzen, Algen, Tieren oder deren Teilen, Pflanzen oder Pflanzenteilen bestehen oder daraus isoliert oder erzeugt oder durch neuartige, nicht übliche Verfahren hergestellt wurden. Welche Lebensmittel zählen zu den Novel Foods? Zu den Novel Foods zählen Lebensmittel wie: Chiasamen Essbare Insekten Spezielle Algenarten Durch Nanotechnik hergestelltes Klonfleisch Baobab-Früchte Wasserkastanien Krill-Öl Früchte des Noni-Baums Produkte mit cholesterinsenkenden Zusätzen Traditionelle Lebensmittel Traditionelle Lebensmittel sind eine Untergruppe der neuartigen Lebensmittel und beziehen sich auf Lebensmittel, die traditionell in Ländern außerhalb Europas seit mindestens 25 Jahren konsumiert werden und als sicher gelten. Wer ist für die Zulassung zuständig? Das Zulassungsverfahren wird von der Europäischen Kommission und der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) durchgeführt. Lebensmittelhersteller müssen, falls sie ein neuartiges Lebensmittel in Verkehr bringen möchten, welches sich noch nicht in der Unionsliste zugelassener neuartiger Lebensmittel befindet, einen Zulassungsantrag bei der Europäischen Kommission stellen.

Blasenentzündung, was tun?!
Blasenentzündung betrifft mehr Frauen als Männer Frauen leiden aufgrund der kürzeren Harnröhre deutlich häufiger an Blasenentzündungen als Männer. Etwa 60 % aller Frauen erleiden im Laufe ihres Lebens mindestens eine Harnwegsinfektion. 30-40 % erleiden wiederkehrende Harnwegsinfektionen, die die Lebensqualität stark einschränken können. Symptome einer Blasenentzündung Die Symptome einer Blasenentzündung reichen von häufigem Harndrang und somit häufigem Wasserlassen bis hin zu Schmerzen beim Wasserlassen und Krämpfen im Unterleib. Wandern die Bakterien aus der Blase die Harnleiter in die Nieren hoch, kann es zudem zu einer Nierenbeckenentzündung inklusive Fieber, Schüttelfrost und starken Schmerzen in beiden Flanken kommen. Gründe für Blasenentzündungen Eine Blasenentzündung wird in der Regel durch Bakterien, seltener auch durch Viren, Parasiten oder Pilze ausgelöst. In den meisten Fällen handelt es sich um Schmierinfektionen mit Escherichia Coli“ (E. coli Bakterien), die sich am Darmausgang befinden. Diese können zum einen durch Geschlechtsverkehr die Harnröhre in die Blase hochwandern, zum anderen durch eine falsche Toilettenhygiene in die Scheide getragen werden. Um letzteres zu verhindern, sollten Frauen nach dem Toilettengang darauf achten, sich von der Scheide zum Darmausgang zu säubern und nicht vom Darmausgang zur Scheide. Risikofaktoren für die Entstehung einer Blasenentzündung sind darüber hinaus eine Unterkühlung, Diabetes mellitus, eine Schwangerschaft oder ein geschwächtes Immunsystem durch z.B. langanhaltenden Stress. Was kann vorbeugend unternommen werden? Der regelmäßige Konsum von Cranberrys oder Cranberry-Muttersaft kann helfen, das Auftreten von wiederkehrenden Blasenentzündungen zu reduzieren. Neben Cranberry-Saft wird zudem häufig die Einnahme von D-Mannose empfohlen. Hierbei handelt es sich um einen Einfachzucker, der nicht verstoffwechselt und somit über das Harnsystem ausgeschieden wird. D-Mannose soll die Einnistung von E. coli Bakterien in die Epithelzellen der Blase hemmen, wodurch diese ausgeschwemmt werden und keine Entzündung verursachen können. Sobald sich die Bakterien in den Zellen der Blase eingenistet haben, kann D-Mannose diese beschriebene Wirkung nicht mehr entfalten, weswegen sie vor allem präventiv (vorbeugend) eingesetzt wird. Was kann im Akut-Fall unternommen werden? Sobald erste Anzeichen, wie z.B. Schmerzen beim Wasserlassen verspürt werden, sollte in jedem Falle auf eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme geachtet werden. Es wird empfohlen mindestens 2 Liter, vorzugsweise Wasser und Tees, die einen harntreibenden Effekt haben, wie beispielsweise spezielle Nieren- und Blasentees, oder Brennnesseltee, am Tag zu trinken. Dem Körper sollte Ruhe gegönnt werden. Wärme durch z.B. Kirschkernkissen oder einer Wärmflasche kann ebenfalls angewendet werden. Falls die Blasenentzündung nicht besser wird, sollte in jedem Falle ein Arzt aufgesucht werden, um schlimmere Komplikationen zu vermeiden. *Disclaimer: Dieses Wissensmagazin ersetzt keinen ärztlichen Ratschlag. Bei einer Blasenentzündung solltest du einen Arzt aufsuchen.
Blasenentzündung, was tun?!
Blasenentzündung betrifft mehr Frauen als Männer Frauen leiden aufgrund der kürzeren Harnröhre deutlich häufiger an Blasenentzündungen als Männer. Etwa 60 % aller Frauen erleiden im Laufe ihres Lebens mindestens eine Harnwegsinfektion. 30-40 % erleiden wiederkehrende Harnwegsinfektionen, die die Lebensqualität stark einschränken können. Symptome einer Blasenentzündung Die Symptome einer Blasenentzündung reichen von häufigem Harndrang und somit häufigem Wasserlassen bis hin zu Schmerzen beim Wasserlassen und Krämpfen im Unterleib. Wandern die Bakterien aus der Blase die Harnleiter in die Nieren hoch, kann es zudem zu einer Nierenbeckenentzündung inklusive Fieber, Schüttelfrost und starken Schmerzen in beiden Flanken kommen. Gründe für Blasenentzündungen Eine Blasenentzündung wird in der Regel durch Bakterien, seltener auch durch Viren, Parasiten oder Pilze ausgelöst. In den meisten Fällen handelt es sich um Schmierinfektionen mit Escherichia Coli“ (E. coli Bakterien), die sich am Darmausgang befinden. Diese können zum einen durch Geschlechtsverkehr die Harnröhre in die Blase hochwandern, zum anderen durch eine falsche Toilettenhygiene in die Scheide getragen werden. Um letzteres zu verhindern, sollten Frauen nach dem Toilettengang darauf achten, sich von der Scheide zum Darmausgang zu säubern und nicht vom Darmausgang zur Scheide. Risikofaktoren für die Entstehung einer Blasenentzündung sind darüber hinaus eine Unterkühlung, Diabetes mellitus, eine Schwangerschaft oder ein geschwächtes Immunsystem durch z.B. langanhaltenden Stress. Was kann vorbeugend unternommen werden? Der regelmäßige Konsum von Cranberrys oder Cranberry-Muttersaft kann helfen, das Auftreten von wiederkehrenden Blasenentzündungen zu reduzieren. Neben Cranberry-Saft wird zudem häufig die Einnahme von D-Mannose empfohlen. Hierbei handelt es sich um einen Einfachzucker, der nicht verstoffwechselt und somit über das Harnsystem ausgeschieden wird. D-Mannose soll die Einnistung von E. coli Bakterien in die Epithelzellen der Blase hemmen, wodurch diese ausgeschwemmt werden und keine Entzündung verursachen können. Sobald sich die Bakterien in den Zellen der Blase eingenistet haben, kann D-Mannose diese beschriebene Wirkung nicht mehr entfalten, weswegen sie vor allem präventiv (vorbeugend) eingesetzt wird. Was kann im Akut-Fall unternommen werden? Sobald erste Anzeichen, wie z.B. Schmerzen beim Wasserlassen verspürt werden, sollte in jedem Falle auf eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme geachtet werden. Es wird empfohlen mindestens 2 Liter, vorzugsweise Wasser und Tees, die einen harntreibenden Effekt haben, wie beispielsweise spezielle Nieren- und Blasentees, oder Brennnesseltee, am Tag zu trinken. Dem Körper sollte Ruhe gegönnt werden. Wärme durch z.B. Kirschkernkissen oder einer Wärmflasche kann ebenfalls angewendet werden. Falls die Blasenentzündung nicht besser wird, sollte in jedem Falle ein Arzt aufgesucht werden, um schlimmere Komplikationen zu vermeiden. *Disclaimer: Dieses Wissensmagazin ersetzt keinen ärztlichen Ratschlag. Bei einer Blasenentzündung solltest du einen Arzt aufsuchen.

Küchenhygiene
Eine gute Küchenhygiene ist wichtig, um sich oder Personen, die die zubereitete Mahlzeit verzehren, vor Keimen zu schützen. Diese sind für den Verbraucher mit bloßem Auge nicht erkennbar und stellen somit eine „unsichtbare Gefahr“ dar. Küchenutensilien Werden für die Zubereitung von Mahlzeiten rohe Produkte wie Fisch, Fleisch oder Eier verwendet, sollten bei der Küchenarbeit unterschiedliche Küchenutensilien (Schneidebretter, Messer, Sieb, …) verwendet werden. Wird rohes Fleisch in einem Sieb gewaschen, sollte (um Kontaminationen zu vermeiden) darauf geachtet werden, danach beispielsweise nicht den Salat im gleichen (ungewaschenen) Sieb zu säubern. Auch Arbeitsflächen, die mit rohen Lebensmitteln in Kontakt gekommen sind, sollten danach gereinigt werden. Achtung Kühlkette Bei leicht verderblichen Lebensmitteln (Fleisch, Fleischerzeugnisse, Fisch, …) sollte darauf geachtet werden, die Kühlkette einzuhalten. Bei längeren Fahrten zwischen dem Lebensmittelmarkt und zuhause sollten diese Lebensmittel vorsichtshalber in Kühltaschen transportiert werden. Aufgetaute Lebensmittel sollten nicht erneut eingefroren werden. Tiefkühlware Tiefkühlware sollte im Optimalfall im Kühlschrank und nicht bei Zimmertemperatur aufgetaut werden. Das Abtauwasser sollte vor der Zubereitung von Lebensmittel abgewaschen werden. Auch Tiefkühlobst sollte im Idealfall (um eventuelle Keime unschädlich zu machen) vor dem Verzehr erhitzt werden. Verbrauchsdatum Bei der Zubereitung von leicht verderblichen (verpackten) Lebensmitteln sollte stets das Verbrauchsdatum eingehalten werden. Das Verbrauchsdatum (auch Ablaufdatum/ Verfallsdatum genannt) gibt das Datum an, bis zu dem das Lebensmittel maximal verzehrt werden sollte. Gekennzeichnet wird das Verbrauchsdatum durch die Angabe: „zu verbrauchen bis…“. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) gibt folgende Auskunft über das Verbrauchsdatum: „Nach Ablauf des Verbrauchsdatums besteht eine Gesundheitsgefahr für Menschen durch Keime, die für Verbraucher nicht erkennbar sind. "Deshalb dürfen Lebensmittel mit abgelaufenem Verbrauchsdatum nicht verkauft und sollten auch nicht mehr verzehrt werden.“
Küchenhygiene
Eine gute Küchenhygiene ist wichtig, um sich oder Personen, die die zubereitete Mahlzeit verzehren, vor Keimen zu schützen. Diese sind für den Verbraucher mit bloßem Auge nicht erkennbar und stellen somit eine „unsichtbare Gefahr“ dar. Küchenutensilien Werden für die Zubereitung von Mahlzeiten rohe Produkte wie Fisch, Fleisch oder Eier verwendet, sollten bei der Küchenarbeit unterschiedliche Küchenutensilien (Schneidebretter, Messer, Sieb, …) verwendet werden. Wird rohes Fleisch in einem Sieb gewaschen, sollte (um Kontaminationen zu vermeiden) darauf geachtet werden, danach beispielsweise nicht den Salat im gleichen (ungewaschenen) Sieb zu säubern. Auch Arbeitsflächen, die mit rohen Lebensmitteln in Kontakt gekommen sind, sollten danach gereinigt werden. Achtung Kühlkette Bei leicht verderblichen Lebensmitteln (Fleisch, Fleischerzeugnisse, Fisch, …) sollte darauf geachtet werden, die Kühlkette einzuhalten. Bei längeren Fahrten zwischen dem Lebensmittelmarkt und zuhause sollten diese Lebensmittel vorsichtshalber in Kühltaschen transportiert werden. Aufgetaute Lebensmittel sollten nicht erneut eingefroren werden. Tiefkühlware Tiefkühlware sollte im Optimalfall im Kühlschrank und nicht bei Zimmertemperatur aufgetaut werden. Das Abtauwasser sollte vor der Zubereitung von Lebensmittel abgewaschen werden. Auch Tiefkühlobst sollte im Idealfall (um eventuelle Keime unschädlich zu machen) vor dem Verzehr erhitzt werden. Verbrauchsdatum Bei der Zubereitung von leicht verderblichen (verpackten) Lebensmitteln sollte stets das Verbrauchsdatum eingehalten werden. Das Verbrauchsdatum (auch Ablaufdatum/ Verfallsdatum genannt) gibt das Datum an, bis zu dem das Lebensmittel maximal verzehrt werden sollte. Gekennzeichnet wird das Verbrauchsdatum durch die Angabe: „zu verbrauchen bis…“. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) gibt folgende Auskunft über das Verbrauchsdatum: „Nach Ablauf des Verbrauchsdatums besteht eine Gesundheitsgefahr für Menschen durch Keime, die für Verbraucher nicht erkennbar sind. "Deshalb dürfen Lebensmittel mit abgelaufenem Verbrauchsdatum nicht verkauft und sollten auch nicht mehr verzehrt werden.“

Lebensmittelsicherheit
Keime in Tiefkühlprodukten?! Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit empfiehlt Tiefkühlware wie Obst und Gemüse vor dem Verzehr zu erhitzen. Vor allem Erdbeeren können auf Grund ihres Kontaktes mit dem Erdboden unterschiedlich stark mit Mikroorganismen belastet sein. Tiefgefrorene Beeren waren des Öfteren bereits Auslöser für lebensmittelbedingte Krankheitsausbrüche mit Hepatitis-A-Viren oder Noroviren. Im Jahr 2012 erkrankten tausende Kinder und Jugendliche in Deutschland, nachdem sie in der Schulverpflegung mit Noroviren belastete tiefgekühlte Erdbeeren aus China verzehrt hatten. Ursachen einer Kontamination mit Noroviren können beispielsweise verunreinigtes Bewässerungswasser, unsachgemäße Düngung und mangelnde Personalhygiene bei der Ernte und Weiterverarbeitung der Beeren sein. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) empfiehlt Tiefkühlobst auf Grund einer möglichen Belastung mit Pflanzenschutzmitteln und einer möglichen mikrobiellen Verunreinigung vor dem Verzehr zu waschen und zu erhitzen. Keime in rohen Eiern?! Rohe Eier bzw. aus ihnen hergestellte Speisen wie Tiramisu oder Mayonnaise können Krankheitserreger wie Campylobacter oder Salmonellen enthalten. Die Keime sind vor allem auf der Eierschale vorzufinden. Eine Belastung von Rohprodukten mit diesen Krankheitserregern ist auch bei noch so strenger Kontrolle der Rohware nicht vollständig auszuschließen, weshalb Lebensmittel wie Tiramisu frisch verzehrt und auch bei guter Kühlung nur wenige Stunden aufgehoben werden sollten. Kochutensilien, die mit rohen Eiern oder der Schale in Kontakt kommen, sollten heiß gespült werden, bevor sie mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommen. Durch gründliches Erhitzen von Eiern oder Eiprodukten können die meisten Infektionen vermieden werden. Keime in abgepackten Salaten?! Das feuchte Milieu, das in Packungen abgepackter Salate herrscht, begünstigt die Vermehrung von Keimen. Fertig geschnittene und abgepackte Salate sind aus diesem Grund nicht selten mit Krankheitserregern belastet. Für das amtliche Zoonosen-Monitoring wurden im Jahr 2021 über 400 Proben von Feldsalat, Rucola und Pflücksalat in Fertigpackungen untersucht. In fast jeder zweiten Probe (ca. 47 %) wurden Bakterien nachgewiesen, die bei hohen Keimzahlen zu Erbrechen und Durchfall führen können. Menschen mit einem geschwächten Immunsystem sollten aus diesem Grund vorsichtshalber keinen abgepackten Salat essen. Welche Menschen zählen zu den besonders empfindlichen Personengruppen? Gewisse Menschen zählen auf Grund ihrer beeinträchtigten oder noch nicht vollständig ausgebildeten Abwehrkräfte gegenüber lebensmittelbedingten Infektionen zu den besonders empfindlichen Personengruppen. Diese Personen sollten besonders auf die Lebensmittelsicherheit achten. Hierzu zählen: Säuglinge und Kleinkinder bis fünf Jahre Schwangere Senioren Menschen, deren Abwehrkräfte durch Vorerkrankungen oder Medikamenteneinnahme geschwächt sind
Lebensmittelsicherheit
Keime in Tiefkühlprodukten?! Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit empfiehlt Tiefkühlware wie Obst und Gemüse vor dem Verzehr zu erhitzen. Vor allem Erdbeeren können auf Grund ihres Kontaktes mit dem Erdboden unterschiedlich stark mit Mikroorganismen belastet sein. Tiefgefrorene Beeren waren des Öfteren bereits Auslöser für lebensmittelbedingte Krankheitsausbrüche mit Hepatitis-A-Viren oder Noroviren. Im Jahr 2012 erkrankten tausende Kinder und Jugendliche in Deutschland, nachdem sie in der Schulverpflegung mit Noroviren belastete tiefgekühlte Erdbeeren aus China verzehrt hatten. Ursachen einer Kontamination mit Noroviren können beispielsweise verunreinigtes Bewässerungswasser, unsachgemäße Düngung und mangelnde Personalhygiene bei der Ernte und Weiterverarbeitung der Beeren sein. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) empfiehlt Tiefkühlobst auf Grund einer möglichen Belastung mit Pflanzenschutzmitteln und einer möglichen mikrobiellen Verunreinigung vor dem Verzehr zu waschen und zu erhitzen. Keime in rohen Eiern?! Rohe Eier bzw. aus ihnen hergestellte Speisen wie Tiramisu oder Mayonnaise können Krankheitserreger wie Campylobacter oder Salmonellen enthalten. Die Keime sind vor allem auf der Eierschale vorzufinden. Eine Belastung von Rohprodukten mit diesen Krankheitserregern ist auch bei noch so strenger Kontrolle der Rohware nicht vollständig auszuschließen, weshalb Lebensmittel wie Tiramisu frisch verzehrt und auch bei guter Kühlung nur wenige Stunden aufgehoben werden sollten. Kochutensilien, die mit rohen Eiern oder der Schale in Kontakt kommen, sollten heiß gespült werden, bevor sie mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommen. Durch gründliches Erhitzen von Eiern oder Eiprodukten können die meisten Infektionen vermieden werden. Keime in abgepackten Salaten?! Das feuchte Milieu, das in Packungen abgepackter Salate herrscht, begünstigt die Vermehrung von Keimen. Fertig geschnittene und abgepackte Salate sind aus diesem Grund nicht selten mit Krankheitserregern belastet. Für das amtliche Zoonosen-Monitoring wurden im Jahr 2021 über 400 Proben von Feldsalat, Rucola und Pflücksalat in Fertigpackungen untersucht. In fast jeder zweiten Probe (ca. 47 %) wurden Bakterien nachgewiesen, die bei hohen Keimzahlen zu Erbrechen und Durchfall führen können. Menschen mit einem geschwächten Immunsystem sollten aus diesem Grund vorsichtshalber keinen abgepackten Salat essen. Welche Menschen zählen zu den besonders empfindlichen Personengruppen? Gewisse Menschen zählen auf Grund ihrer beeinträchtigten oder noch nicht vollständig ausgebildeten Abwehrkräfte gegenüber lebensmittelbedingten Infektionen zu den besonders empfindlichen Personengruppen. Diese Personen sollten besonders auf die Lebensmittelsicherheit achten. Hierzu zählen: Säuglinge und Kleinkinder bis fünf Jahre Schwangere Senioren Menschen, deren Abwehrkräfte durch Vorerkrankungen oder Medikamenteneinnahme geschwächt sind

Strahlende Haut von innen heraus
Kann sich die Darmgesundheit auf die Hautgesundheit auswirken? Der Darm und die Haut haben einiges gemeinsam. Sie stellen große Flächen dar, die mit der Außenwelt in Kontakt kommen und beherbergen eine große Bandbreite an Mikroben. Durch die sogenannte Darm-Haut-Achse sind beide Organe miteinander verbunden. Wie beide Organe miteinander kommunizieren, ist noch nicht gänzlich erforscht. Es wird davon ausgegangen, dass ein Großteil der Kommunikation über das Immunsystem stattfindet. Es konnte festgestellt werden, dass sich eine negative Veränderung der mikrobiellen Vielfalt im Darm (Dysbiose) auf die Gesundheit der Haut auswirken kann. Mehrere dermatologische Erkrankungen wie beispielsweise Akne, atopische Dermatitis, Psoriasis und Rosazea stehen mit einer Dysbiose des Darm-Mikrobioms in Verbindung. Wer also sein Hautbild verbessern möchte, sollte seinen Fokus im Optimalfall nicht nur auf die Haut, sondern auch auf den Darm legen. Ernährung – das kleine ABC Um die Darmgesundheit zu fördern und den Körper mit Mikronährstoffen zu versorgen, sollte die Ernährung so bunt und vielfältig wie möglich sein. Integriere genügend Ballaststoffe in Form von beispielsweise Gemüse, Obst, und Hülsenfrüchten. Achte auf eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme über den Tag verteilt und meide Genussmittel wie Alkohol, Tabak und Zucker. Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe Hinsichtlich der Hautgesundheit kann laut Studienlage vor allem eine ausreichende Versorgung mit folgenden Vitaminen, Mineralstoffen, sekundären Pflanzenstoffen und Fettsäuren positive Wirkungen erzielen: Vitamin A Vitamin B7 (Biotin) Vitamin C Vitamin D Vitamin E Kupfer Selen Silicium Zink Polyphenole (z.B. Curcumin, Polyphenole aus Beeren) Carotinoide (z.B. aus Karotten, Tomaten, …) Omega-3-Fettsäuren Kollagen Studien zeigen, dass eine regelmäßige Einnahme von niedrig molekularen Kollagen-Peptiden sowohl die Hydratation und die Elastizität der Haut verbessern als auch der Hautalterung entgegenwirken kann.
Strahlende Haut von innen heraus
Kann sich die Darmgesundheit auf die Hautgesundheit auswirken? Der Darm und die Haut haben einiges gemeinsam. Sie stellen große Flächen dar, die mit der Außenwelt in Kontakt kommen und beherbergen eine große Bandbreite an Mikroben. Durch die sogenannte Darm-Haut-Achse sind beide Organe miteinander verbunden. Wie beide Organe miteinander kommunizieren, ist noch nicht gänzlich erforscht. Es wird davon ausgegangen, dass ein Großteil der Kommunikation über das Immunsystem stattfindet. Es konnte festgestellt werden, dass sich eine negative Veränderung der mikrobiellen Vielfalt im Darm (Dysbiose) auf die Gesundheit der Haut auswirken kann. Mehrere dermatologische Erkrankungen wie beispielsweise Akne, atopische Dermatitis, Psoriasis und Rosazea stehen mit einer Dysbiose des Darm-Mikrobioms in Verbindung. Wer also sein Hautbild verbessern möchte, sollte seinen Fokus im Optimalfall nicht nur auf die Haut, sondern auch auf den Darm legen. Ernährung – das kleine ABC Um die Darmgesundheit zu fördern und den Körper mit Mikronährstoffen zu versorgen, sollte die Ernährung so bunt und vielfältig wie möglich sein. Integriere genügend Ballaststoffe in Form von beispielsweise Gemüse, Obst, und Hülsenfrüchten. Achte auf eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme über den Tag verteilt und meide Genussmittel wie Alkohol, Tabak und Zucker. Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe Hinsichtlich der Hautgesundheit kann laut Studienlage vor allem eine ausreichende Versorgung mit folgenden Vitaminen, Mineralstoffen, sekundären Pflanzenstoffen und Fettsäuren positive Wirkungen erzielen: Vitamin A Vitamin B7 (Biotin) Vitamin C Vitamin D Vitamin E Kupfer Selen Silicium Zink Polyphenole (z.B. Curcumin, Polyphenole aus Beeren) Carotinoide (z.B. aus Karotten, Tomaten, …) Omega-3-Fettsäuren Kollagen Studien zeigen, dass eine regelmäßige Einnahme von niedrig molekularen Kollagen-Peptiden sowohl die Hydratation und die Elastizität der Haut verbessern als auch der Hautalterung entgegenwirken kann.

Olivenöl und seine Vorzüge
Natives Olivenöl extra ist ein fester Bestandteil der mediterranen Ernährung, der viele positive gesundheitliche Effekte zugeschrieben wird. Einige dieser Effekte kommen auf Grund des Olivenöls zustande, das nicht nur einen hohen Anteil von ungesättigten Fettsäuren, sondern auch sekundären Pflanzenstoffen (sogenannte Polyphenole) enthält. Natives Olivenöl, Blutfette und Insulinsensitivität Die regelmäßige Aufnahme von nativem Olivenöl extra kann sich sowohl auf die Blutfettwerte, den Blutdruck als auch den Blutzucker positiv auswirken. Hierdurch kann sich die Insulinsensitivität verbessern und das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen reduzieren. Eine Insulinresistenz wird als Ursache vieler Zivilisationserkrankungen wie beispielsweise dem metabolischen Syndrom in Verbindung gebracht. Natives Olivenöl und Darmgesundheit Die Rolle der Darmgesundheit bei der Aufrechterhaltung des Schleimhaut Immunsystems und ihr Einfluss auf den allgemeinen Entzündungsstatus sowie die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems, des Stoffwechsels und des Gehirns werden immer deutlicher. Der Konsum von Nativem Olivenöl extra konnte in Studien positive Effekte auf die Darmmikrobiota und somit die Darmgesundheit zeigen. So kann natives Olivenöl extra das Wachstum nützlicher Bakterien fördern. Der Großteil der aufgenommenen Phenolverbindungen gelangt in den Dickdarm, wo sie von den dort ansässigen Darmbakterien verstoffwechselt werden und so die Zusammensetzung der Darmmikrobiota verändern können. Natives Olivenöl und Alzheimer Die Alzheimer-Krankheit ist eine fortschreitende neurodegenerative Erkrankung, bei der es unter anderem zu Ablagerungen (Plaques), Neuroinflammation (Entzündung des Nervengewebes) und Störungen der Blut-Hirn-Schranke kommt. Aktuelle Behandlungen können die Lebensqualität der Patienten zwar verbessern, die Erkrankung jedoch nicht heilen. Mehrere Studien zeigen, dass natives Olivenöl extra durch dessen Gehalt an phenolischen Verbindungen das Risiko einer leichten kognitiven Beeinträchtigung und die von Alzheimer verringern kann. Die Ergebnisse der Studien deuten darauf hin, dass die poly phenolischen Bestandteile wichtige Prozesse der Alzheimer-Krankheit positiv beeinflussen – darunter unter anderem die Plaquebildung, die Neuroinflammation, sowie die Funktionsweise der Blut-Hirnschranke. Darf Olivenöl erhitzt werden? Olivenöl kann bis zu einer Temperatur von ca. 180 Grad Celsius erhitzt werden. Wird das Öl über diese Temperatur hinaus erhitzt, können die positiv wirkenden phenolischen Verbindungen zerstört werden.
Olivenöl und seine Vorzüge
Natives Olivenöl extra ist ein fester Bestandteil der mediterranen Ernährung, der viele positive gesundheitliche Effekte zugeschrieben wird. Einige dieser Effekte kommen auf Grund des Olivenöls zustande, das nicht nur einen hohen Anteil von ungesättigten Fettsäuren, sondern auch sekundären Pflanzenstoffen (sogenannte Polyphenole) enthält. Natives Olivenöl, Blutfette und Insulinsensitivität Die regelmäßige Aufnahme von nativem Olivenöl extra kann sich sowohl auf die Blutfettwerte, den Blutdruck als auch den Blutzucker positiv auswirken. Hierdurch kann sich die Insulinsensitivität verbessern und das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen reduzieren. Eine Insulinresistenz wird als Ursache vieler Zivilisationserkrankungen wie beispielsweise dem metabolischen Syndrom in Verbindung gebracht. Natives Olivenöl und Darmgesundheit Die Rolle der Darmgesundheit bei der Aufrechterhaltung des Schleimhaut Immunsystems und ihr Einfluss auf den allgemeinen Entzündungsstatus sowie die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems, des Stoffwechsels und des Gehirns werden immer deutlicher. Der Konsum von Nativem Olivenöl extra konnte in Studien positive Effekte auf die Darmmikrobiota und somit die Darmgesundheit zeigen. So kann natives Olivenöl extra das Wachstum nützlicher Bakterien fördern. Der Großteil der aufgenommenen Phenolverbindungen gelangt in den Dickdarm, wo sie von den dort ansässigen Darmbakterien verstoffwechselt werden und so die Zusammensetzung der Darmmikrobiota verändern können. Natives Olivenöl und Alzheimer Die Alzheimer-Krankheit ist eine fortschreitende neurodegenerative Erkrankung, bei der es unter anderem zu Ablagerungen (Plaques), Neuroinflammation (Entzündung des Nervengewebes) und Störungen der Blut-Hirn-Schranke kommt. Aktuelle Behandlungen können die Lebensqualität der Patienten zwar verbessern, die Erkrankung jedoch nicht heilen. Mehrere Studien zeigen, dass natives Olivenöl extra durch dessen Gehalt an phenolischen Verbindungen das Risiko einer leichten kognitiven Beeinträchtigung und die von Alzheimer verringern kann. Die Ergebnisse der Studien deuten darauf hin, dass die poly phenolischen Bestandteile wichtige Prozesse der Alzheimer-Krankheit positiv beeinflussen – darunter unter anderem die Plaquebildung, die Neuroinflammation, sowie die Funktionsweise der Blut-Hirnschranke. Darf Olivenöl erhitzt werden? Olivenöl kann bis zu einer Temperatur von ca. 180 Grad Celsius erhitzt werden. Wird das Öl über diese Temperatur hinaus erhitzt, können die positiv wirkenden phenolischen Verbindungen zerstört werden.

Zyklus Basierte Ernährung im Sport?
Welche Phasen hat der weibliche Zyklus? Der weibliche Zyklus kann zwischen 21 und 35 Tage betragen. Als Ideal werden häufig 28 Tage dargestellt. In der Realität schwanken die Zyklen (bei hormonfreier Verhütung) in ihrer Länge meist um ein paar Tage. Jeder Zyklus kann in drei Phasen unterteilt werden: Follikelphase (erste Zyklushälfte) Ovulationsphase (Phase, in der der Eisprung stattfindet) Lutealphase (zweite Zyklushälfte) Über diese Phasen hinweg kommt es zu Hormonschwankungen. Von niedrigen Östrogen- und Progesteronspiegeln in der frühen Follikelphase (zu Beginn des Zyklus), einem hohen Östrogenspiegel gleichzeitig niedrigen Progesteronspiegel in der späten Follikelphase, bis hin zu einem hohen Östrogen- und Progesteronspiegel in der Lutealphase nach dem Eisprung. Zum Ende des Zyklus nehmen sowohl der Östrogen- als auch der Progesteronspiegel wieder ab, wodurch die Menstruation und somit ein neuer Zyklus beginnen. Was empfiehlt die International Society of Sports Nutrition? Die International Society of Sports Nutrition (ISSN) empfiehlt Sportlerinnen im gebärfähigen Alter ihren hormonellen Status (sei er natürlich oder mit Einfluss von externen Hormonen wie der Anti-Baby-Pille) anhand von Training und Erholung zu tracken, um individuelle Muster und Bedürfnisse zu bestimmen. Vor allem auf eine angemessene Energieaufnahme sollte geachtet werden, um den Energiebedarf zu decken und eine optimale Versorgung zu erreichen. Der Kohlenhydratbedarf sollte in allen Phasen des Menstruationszyklus gedeckt werden. Ein besonderes Augenmerk auf die Kohlenhydrataufnahme sollte insbesondere während der aktiven Pillenwochen und während der Lutealphase gelegt werden. Um den Umbau und die Reparatur der Muskulatur einzuleiten, empfiehlt die ISSN, Eiweiß in einer Dosis von ca. 0,3-0,4 g pro kg Körpergewicht so nah wie möglich am Beginn und/oder nach Abschluss des Trainings zu konsumieren. Die tägliche Proteinzufuhr sollte innerhalb der mittleren bis oberen Bereiche der aktuellen Sport Ernährungsrichtlinien (1,4 - 2,2 g pro kg Körpergewicht) mit gleichmäßig verteilten Protein Dosen (alle 3-4 Stunden über den Tag verteilt) liegen. Fazit Die Ernährung sollte sich vor allem an der ausgeführten Sportart orientieren, um ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.
Zyklus Basierte Ernährung im Sport?
Welche Phasen hat der weibliche Zyklus? Der weibliche Zyklus kann zwischen 21 und 35 Tage betragen. Als Ideal werden häufig 28 Tage dargestellt. In der Realität schwanken die Zyklen (bei hormonfreier Verhütung) in ihrer Länge meist um ein paar Tage. Jeder Zyklus kann in drei Phasen unterteilt werden: Follikelphase (erste Zyklushälfte) Ovulationsphase (Phase, in der der Eisprung stattfindet) Lutealphase (zweite Zyklushälfte) Über diese Phasen hinweg kommt es zu Hormonschwankungen. Von niedrigen Östrogen- und Progesteronspiegeln in der frühen Follikelphase (zu Beginn des Zyklus), einem hohen Östrogenspiegel gleichzeitig niedrigen Progesteronspiegel in der späten Follikelphase, bis hin zu einem hohen Östrogen- und Progesteronspiegel in der Lutealphase nach dem Eisprung. Zum Ende des Zyklus nehmen sowohl der Östrogen- als auch der Progesteronspiegel wieder ab, wodurch die Menstruation und somit ein neuer Zyklus beginnen. Was empfiehlt die International Society of Sports Nutrition? Die International Society of Sports Nutrition (ISSN) empfiehlt Sportlerinnen im gebärfähigen Alter ihren hormonellen Status (sei er natürlich oder mit Einfluss von externen Hormonen wie der Anti-Baby-Pille) anhand von Training und Erholung zu tracken, um individuelle Muster und Bedürfnisse zu bestimmen. Vor allem auf eine angemessene Energieaufnahme sollte geachtet werden, um den Energiebedarf zu decken und eine optimale Versorgung zu erreichen. Der Kohlenhydratbedarf sollte in allen Phasen des Menstruationszyklus gedeckt werden. Ein besonderes Augenmerk auf die Kohlenhydrataufnahme sollte insbesondere während der aktiven Pillenwochen und während der Lutealphase gelegt werden. Um den Umbau und die Reparatur der Muskulatur einzuleiten, empfiehlt die ISSN, Eiweiß in einer Dosis von ca. 0,3-0,4 g pro kg Körpergewicht so nah wie möglich am Beginn und/oder nach Abschluss des Trainings zu konsumieren. Die tägliche Proteinzufuhr sollte innerhalb der mittleren bis oberen Bereiche der aktuellen Sport Ernährungsrichtlinien (1,4 - 2,2 g pro kg Körpergewicht) mit gleichmäßig verteilten Protein Dosen (alle 3-4 Stunden über den Tag verteilt) liegen. Fazit Die Ernährung sollte sich vor allem an der ausgeführten Sportart orientieren, um ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.
Dein Experten Team
Madeleine Beer
Dr. Prof. Pavel Dufek
Seyit Ali Shobeiri
Stefania Shobeiri
Noch mehr Gutes für dich!
Bekannt aus:
Von Expert*innen entwickelt
Alle Produkte werden zusammenmit Ernährungswissenschaftlern &- medizinern entwickelt.
100% Natürlich
Wir setzen bei der Auswahl der Rohstoffe auf natürliche Zutaten und verzichten auf Zusatzstoffe.
Made in Germany
IAMSTR® Nutrition wird in Deutschland entwickelt und produziert.
Wissenschaftliche Basis
Die Produkte enthalten Inhaltsstoffe in evidenzbasierter Dosierung mit einer hohen Bioverfügbarkeit.








